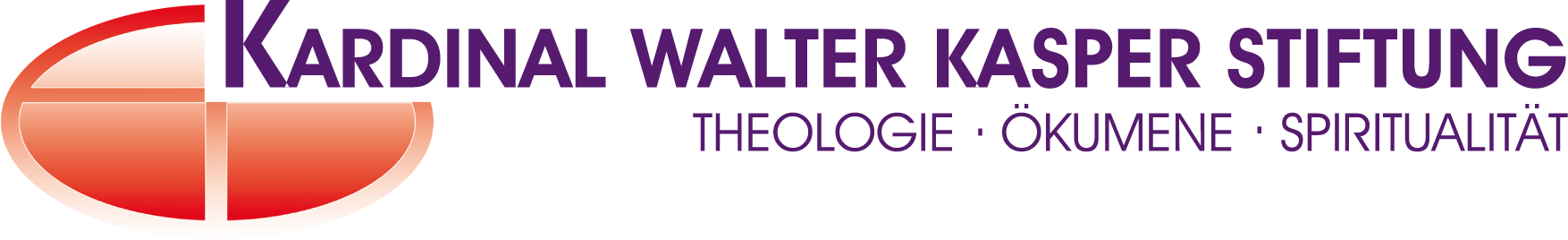Was heißt es Theologie zu treiben?
Dankrede nach der Verleihung der Theologischen Preises
der Salzburger Hochschulwochen
Kardinal Walter Kasper
In der letzten Stunde ist viel über mich und mein theologisches Denken geredet worden. Nun ist es an der Zeit, dass ich meinerseits den Salzburger Hochschulwochen meine herzlichsten Glückwünsche zu ihrem 75. Geburtstag ausspreche. Die Salzburger Hochschulwochen sind damit genau zwei Jahre älter als ich es bin. Mit diesem Glückwunsch verbinde ich meine Anerkennung für den wichtigen Dienst, den die Hochschulwochen in diesem dramatisch verlaufenen dreiviertel Jahrhundert für die Kirche in den deutschsprachigen Ländern geleistet haben. Besonders zu danken habe ich dem Präsidium und dem Direktorium der Salzburger Hochschulwochen für die mir zuteil gewordene Ehrung. Mein Dank gilt selbstverständlich dem Laudator, dem Tübinger Kollegen, Herrn Professor Eberhard Jüngel, dem Kammerorchester, sowie Ihnen allen, die Sie zu dieser Feier gekommen sind.
I.
Karl Rahner, für meine Generation einer der großen Lehrmeister der Theologie, hat nach einer Laudatio, die ich über ihn gehalten hatte, geantwortet, er hoffe, dass möglichst wenig von seiner Theologie nur „seine“ Theologie sei. Diesem Wunsch schließe ich mich an.
Theologie kann nie nur „meine“ Theologie sein, ebenso wenig wie der Glaube nur „mein“ Glaube ist. Der persönliche Glaube und damit auch die Theologie verdanken sich vielen: den Eltern, Lehrern, Seelsorgern, den Kollegen und Mitarbeitern und nicht zuletzt dem kritischen Gespräch mit den Studierenden, letztlich dem größeren Wir der Kirche. „Wir glauben“ heißt es in den alten Credo-Formeln. Theologie ist nach-denklich, sie re-flektiert, was sie empfangen hat. Als Glaubenswissenschaft lebt sie in vielfältigen Traditions-, Rezeptions- und Kommunikationszusammenhängen der kirchlichen Glaubensgemeinschaft.
Das ist zumindest die Grundlage und das Selbstverständnis der katholischen Theologie. Das hat nichts mit Linientreue zu tun. Der kirchliche Glaube ist keine Linie. Er ist eher einem weiten Meer, einem riesigen Ozean zu vergleichen. Dazu gehört die Heilige Schrift, sie selbstverständlich zuerst, die Glaubenssymbole der Kirche, die Liturgie, die Kirchenväter, die Schriften der großen Theologen des hohen Mittelalters wie der Neuzeit, das Zeugnis der Heiligen und die Glaubenspraxis des Volkes Gottes, auch die Fragen der Gläubigen. Dazu gehören schließlich auch Literatur und Kunst, nicht zuletzt die Musik. Das alles sind neben dem Lehramt der Kirche loci theologici, d.h. Fundstellen der Theologie. Die hohe Kunst der Theologie besteht darin, diese vielfältigen Zeugnisse zu einem Ganzen zusammenzufügen und zum Klingen zu bringen. Darin ist Theologie mit Musik verwandt. Große Theologen waren darum oft Liebhaber der Musik. Denken sie nur an Karl Barth, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger. Die Wahrheit ist symphonisch (Hans Urs von Balthasar).
Mit diesen ersten Gesichtspunkten habe ich bereits meine Herkunft aus der Tübinger Schule des 19. Jahrhunderts, vor allem von deren wichtigsten und bekanntesten Vertreter, Johann Adam Möhler, angedeutet. Gelegentlich wird die Tübinger Theologie als „liberal“ bezeichnet. Auch mir hat man dieses Etikett immer wieder anhängen wollen. Daran ist nur soviel richtig, dass die Tübinger immer versucht haben, mit dem eigenen Kopf zu denken, als Schwaben gelegentlich auch mit dem eigenen Dickkopf. Die alten Tübinger haben das etwas vornehmer ausgedrückt und sich entsprechend dem Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts als „Selbstdenker“ bezeichnet. Kirchlichkeit, Wissenschaftlichkeit und Offenheit für die Probleme der Zeit waren für sie die drei zusammengehörigen Merkmale ihres theologischen Denkens.
So waren die Tübinger fest in der Tradition verwurzelt und zugleich offen für neue Fragen und Herausforderungen der Zeit. Sie verstanden Tradition als lebendige Tradition, d.h. als Überlieferung, die man nur hat indem man sie lebendig weitergibt. Darum waren konservativ und progressiv für sie keine sich ausschließenden Gegensätze. Sie verhalten sich nicht kontradiktorisch, sondern komplementär. Radikale Thesen haben es demgegenüber immer einfacher, die Extreme zusammenzuhalten und nach Möglichkeit zusammenzudenken ist dagegen anstrengend. Man nennt dies „vermitteln“, was nichts anderes heißt als: Theologie muss denken!
II.
Das führt mich zum zweiten Gesichtspunkt. Theologie ist dem Axiom der „Fides quaerens intellectum“ verpflichtet. Die Re-flexion des Glaubens der Kirche darf nicht zu einem vernunftscheuen geistlosen Positivismus werden. Die Theologie muss vielmehr Rechenschaft (apologia) geben von der Hoffnung, die in uns ist (1 Petr 3,15). Paulus nennt dies einen vernunftgemäßen Gottesdienst (logike latreia) (Röm 12,1).
Eine frühe Preisarbeit machte mich bereits als Student mit Thomas von Aquin, dem wohl bedeutendsten und bis heute einflussreichen theologischen Denker des hohen Mittelalters vertraut. Später wurde Thomas zunehmend wichtig für mich. Im Anschluss an Thomas schien mir die ontologische, d.h. seinsmäßige Fundierung der Theologie wichtig. Denn Gott und Jesus Christus können Bedeutung „für mich“ und „für uns“ nur dann haben, wenn Gott „ist“ und wenn Jesus Christus „wirklich“ auferstanden „ist“ und lebt. Wer sagt, das sei ein versachlichendes substanzhaftes Denken, der hat Thomas entweder nie studiert, oder wenn, ihn nicht verstanden.
In der Habilitationsschrift wandte ich mich der Spätphilosophie Schellings zu. Damit wählte ich einen der großen neuzeitlichern Denker, der im Übergang steht vom Idealismus Hegels zur nachidealistischen Philosophie, zu Kierkegaard, Marx, Nietzsche, die das Denken des 20. Jahrhunderts nachhaltig bestimmt haben. Sowohl Martin Heidegger wie Jürgen Habermas haben sich darum ausführlich mit der Spätphilosophie Schellings auseinandergesetzt.
Bei Schelling werden neuzeitliche Philosophie der Freiheit, Philosophie des spätantiken Neuplatonismus, romantische Philosophie der Natur, Philosophie der Kunst, der Mythologie und der Religion nochmals zusammengedacht. Kein Wunder, dass diese Philosophie nicht nur bei uns im Westen, sondern im vorrevolutionären Russland ebenso wie im heutigen nachmarxistischen Russland, vermittelt durch Vladimir Solovjev, großes Interesse fand und findet.
Durch die Beschäftigung mit Schelling hatte ich einen zwar nicht unkritischen, aber doch einen konstruktiven Zugang zum Problem der neuzeitlichen Philosophie. Dieser differenzierte Zugang zur Neuzeit unterscheidet mich von vielen anderen Theologen. Ich konnte die Neuzeit nie nur als prometheischen Aufstand des Subjekts gegen die von Gott gesetzte objektive Ordnung sehen. Die neuzeitliche Subjektivität ist nämlich etwas anders als ein Subjektivismus der Beliebigkeit. Sie ist eher das Gegenteil. Der Titel meiner Habilitationsschrift lautete nicht umsonst: „Das Absolute in der Geschichte“.
Zum Glück hat die konstruktive Auseinandersetzung mit dem neuzeitlichen Denken inzwischen in der katholischen Theologie eingesetzt mit dem Ergebnis, dass Religiosität und Säkularität (im Unterschied zum ideologischen Säkularismus bzw. Laizismus) keine Gegensätze sind, sondern in der Auseinandersetzung mit den modernen Ideologien wie mit den alten und neuen Mythologien Alliierte. Der biblische Gott vereinnahmt nicht, er setzt frei. Umgekehrt führt eine sich von Gott emanzipierende, gottlos gewordene Freiheit ins Bodenlose. Mit diesem gottlosen Säkularismus hat Europa in kulturgeschichtlicher Hinsicht einen Sonderweg beschritten, der im 20. Jahrhundert in die Katastrophe geführt hat.
Man muss darum die innere Dialektik der Aufklärung (Theodor W. Adorno) sehen. Deshalb hat mir immer die Formel eingeleuchtet, es gelte die Neuzeit von der Gefahr ihrer Destruktion durch sich selbst zu bewahren. Bei dieser Aufgabe sind heute Kirche und Moderne nicht mehr Gegner, sondern Verbündete im Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte. Dies hat Papst Johannes Paul II. in seiner großen Enzyklika „Fides et ratio“ (1998) eindrücklich herausgestellt. Benedikt XVI. liegt auf derselben Linie. Es gilt also, das positive Erbe der Neuzeit einzubringen, in das, was man mit Jürgen Habermas die neue postsäkulare Situation nennen kann.
III.
Damit stehe ich beim Thema der diesjährigen Salzburger Hochschulwochen: „Gott ist im Kommen“. Ja, er ist, um es mit Schleiermacher zu sagen, für die Gebildeten unter seinen Verächtern wieder diskurswürdig und sozusagen salonfähig geworden. Viele Menschen fragen wieder neu nach dem, was das Leben letztlich trägt, hält und erfüllt.
Ich frage mich freilich sofort: Welcher Gott ist im Kommen? Im Zeichen des postmodernen Pluralismus sind viele alte und neue Götter im Kommen. Sie entsteigen entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte aus ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf (Max Weber). Das Thema „Gott ist im Kommen“ beschreibt also eine zutiefst vieldeutige Situation.
Deshalb nochmals: Welcher Gott ist im Kommen? Die Götter des Mythos, der plötzlich wieder modern geworden ist?, der Gott, der Terror und Gewalt rechtfertigt, und der uns Angst und Schrecken einjagt?, oder handelt es sich am Ende doch nur um Projektionen unserer verborgenen Sehnsüchte? Für Christen ist der Gott, der im Kommen ist, der Gott Jesu Christi. Er hat vom Kommen Gottes gesprochen; er war dieses Kommen in Person. Hier ist für uns der Maßstab. Einen anderen Grund kann niemand legen (1 Kor 3,11).
So wurde die Christologie mein Thema. Sie war im Wintersemester 1964/65 das Thema meiner ersten Vorlesung in Münster, und sie ist mein Thema geblieben. Sie ist heute angesichts des postmodernen Religionspluralismus ganz neu aktuell. Als Christen müssen wir von Jesus Christus her Gott denken.
In einem christologischen Kontext Gott zu denken und ihn so zu denken, dass der Gottesgedanke nicht nur den intellektuellen Anfragen, sondern auch und noch mehr dem ungeheuren Ausmaß an Leid im vergangenen Jahrhundert und wie es scheint auch im begonnenen neuen Jahrhundert standhält, ist die große Herausforderung der Theologie, wenigstens dann, wenn sie bei ihrem Leisten bleibt und nicht Allotria treibt.
Gott denken, das heißt das denken, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ja – wie Anselm von Canterbury seinen eigenen Gedanken nochmals überbietend formuliert – das denken, was größer ist als alles, was gedacht werden kann. Er ist das Non plus utra et ultra omni quod cogitari postest. Wenn das keine spannnende Angelegenheit ist!
Das bedeutet zunächst, dass wir – ganz im Sinn der Kirchenväter und auch im Sinn des Thomas von Aquin – von Gott mehr wissen, was er nicht ist, als was er ist. Solche theologia negativa ist eine deutliche Warnung vor theologischem Bescheidwissen wollen und noch mehr eine Warnung davor, Gott frech für unsere Angelegenheiten und Zwecke in Anspruch zu nehmen und ihn vereinnahmen zu wollen. Sie ist eine Kritik aller politischen theologischen Ideologie und Ideolatrie, auch aller Ekklesiolatrie. Man kann es nicht deutlich genug sagen: Die Kirche ist zwar die „heilige Kirche“, wie wir sie im Credo bekennen, aber sie ist nicht Gott. Sie ist eine geschöpfliche Wirklichkeit, und die sichtbare Kirche wird am Ende, wenn Gott „alles in allem“ sein wird (1 Kor 15,28), aufhören.
Schelling hat diese theologia negativa nochmals gesteigert. Für ihn war das non plus ultra und das quo maius cogitari nequit das Kreuz. Denn dass Gott sich ins Gegenteil seiner, in den Tod einlässt, ist in den Augen der Menschen eine Torheit (1 Kor 1,23). Es ist das, was nach menschlichen Maßstäben Gott absolut nicht entspricht. In Wirklichkeit ist dies Ausdruck der Liebe Gottes, die an unserer Stelle für uns eintritt. So hat Gott am Kreuz sich selbst endgültig als Liebe definiert (1 Joh 4,8.16). Es gehört ja zum Wesen der Liebe, dass sie kenotisch ist, d.h. sich selbst entäußert (Phil 2,6 f), dass sie „außer sich“ ist und nur im anderen sie selbst ist. Papst Benedikt XVI. hat das Wort aus dem ersten Johannesbrief, dass Gott Liebe ist zum Titel seiner ersten Enzyklika „Deus caritas est“ (2006) gemacht und damit einen neuen Ton angeschlagen und einen neuen theologischen Akzent gesetzt, über den es sich weiter nachzudenken lohnt.
Die Aussage, dass Gott Liebe ist hat weitreichende Konsequenzen für das christliche Verständnis der Wirklichkeit und des Menschen. Denn Liebe besagt, im anderen seiner selbst und in der Anerkennung der Andersheit des anderen zu sich selbst zu kommen. Solche Liebe vertreibt die Furcht (1 Joh 4,18). Sie vertreibt die Furcht und die Angst vor dem anderen, sowohl die Angst vor dem anderen Menschen in Gestalt des Fremden wie die Angst vor dem ganz anderen, dem Tod. Die Liebe wendet sich dem anderen Menschen zu und tritt für ihn ein. Sie vertreibt die Daseinsangst, die – wie wir seit Kierkegaard und Heidegger wissen – die Grundbefindlichkeit des Menschen ist und die in uns allen nagt. Ernsthafte Theologie ist darum kein bloßes akademisches Glasperlenspiel; sie ist existentieller Ernst. Sie hat dem Menschen „etwas“ zu sagen; sie hat ihm das eine und letztlich einzig Notwendige zu sagen. Für mich war darum die Verkündigung immer der Ernstfall der Theologie.
IV.
Sie erwarten, dass ich zum Schluss noch etwas zur ökumenischen Theologie sage. Ich betrachte das nicht als ein Anhängsel zu dem bisher Gesagten. Denn mit dem soeben Gesagten haben wir ja das berührt, was ernsthafter theologischer Dialog im Unterschied zum Monolog meint, nämlich Selbstfindung im Austausch mit dem anderen.
Ich habe in Tübingen an einer Universität zwei theologischen Fakultäten studiert. Das, was man heute das ökumenische Problem nennt, war damit von vorn herein präsent, freilich ganz anders als dies heute der Fall ist. Damals war es uns verboten, evangelische Vorlesungen zu besuchen. Als ich 1970 nach Tübingen zurückkehrte fand ich eine völlig andere Situation vor. Nach dem II. Vatikanischen Konzil fand zwischen den beiden theologischen Fakultäten ein reger Austausch statt. Ich denke gerne an die anregenden freundschaftlichen Gespräche mit Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann und Hans Küng zurück. Das war eine schöne und interessante Zeit.
Die systematische Befassung mit der Theorie des ökumenischen Dialogs setzte erst ein als ich 1999 meine neue Aufgabe in Rom übernahm. Für mich war von Anfang an klar, dass die ökumenische Theologie nicht ein Sondergebiet neben der übrigen Theologie ist. Sie ist eine durchgängige, eine transversale Dimension jeder Theologie. Theorie und Methode des ökumenischen Dialogs sind darum keine anderen als die der Theologie insgesamt. Für die ökumenische Theologie gelten die gleichen strengen wissenschaftlichen Anforderungen wie für die Theologie überhaupt. Ökumenische Theologie, die diesen Namen verdient, hat darum mit Schummelei absolut nichts im Sinn.
Das Neue und Faszinierende an der ökumenischen Theologie besteht darin, dass in ihr eine bis dahin unerhörte Horizonterweiterung geschieht. Sie steht zwar auf der Grundlage der jeweils eigenen kirchlichen Tradition. Aber sie durchbricht den bisherigen monologischen Charakter der konfessionellen Theologie. Sie beschränkt sich nicht mehr auf die Kommunikations-, Rezeptions- und Konsensprozesse der jeweils eigenen kirchlichen Tradition, sondern bezieht auch die Traditionen der anderen Kirchen ein. Das ist ungemein herausfordernd, ungemein spannend und ungemein bereichernd. Das eröffnet der Theologie eine neue universalere und d.h. eine im ursprünglichen Sinn des Wortes verstandene katholischere Dimension. Es geht dabei nicht – wie törichter Weise immer wieder befürchtet wird – um eine Protestantisierung des Katholischen oder eine Katholisierung des Protestantismus. Beide sollen vielmehr aneinander und im Sicheinlassen aufeinander wachsen und so zusammenwachsen. Es geht – wie Papst Johannes Paul II. es definiert hat – um einen Austausch von Gaben.
Vieles wurde in den letzten Jahrzehnten geleistet. Am deutlichsten war der Fortschritt dort, wo im 16. Jahrhundert die Kontroversen am schärfsten waren, in der Rechtfertigungslehre. Erst vor einer Woche hat sich der methodistische Weltbund der entsprechenden Erklärung zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen Weltbund von 1999 angeschlossen. Einen ähnlichen Erfolg gab es schon zuvor im Verhältnis zu den altorientalischen Kirchen, wo ein über 1500 Jahre alter Konflikt bereinigt wurde. Wir sollten diese Ergebnisse nicht klein reden. Wahr ist freilich, dass uns ein ähnlicher Durchbruch in der Ekklesiologie, besonders in der Amtsfrage und in der Frage des Petrusamtes bisher nicht geschenkt worden ist.
Die nicht ausdiskutierten Unterschiede im Verständnis der Kirche führen naturgemäß zu unterschiedlichen Vorstellungen von der Einheit der Kirche, und das heißt: Wir muten einander unterschiedliche, dem jeweils anderen nicht zumutbare ökumenische Zielvorstellungen zu. Das erzeugt verständlicher Weise gelegentlich Missstimmung.
Im Augenblick ist nicht abzusehen, wie wir aus diesem Engpass herausfinden. Doch grundsätzlich gibt es zum ökumenischen Dialog keine verantwortliche Alternative. Es ist der Auftrag Jesu Christi selbst, der uns dazu verpflichtet, und es wäre um die Glaubwürdigkeit der Kirche geschehen, wenn wir den Dialog kleinmütig aufgeben würden. Es macht darum auch keinen Sinn, statt einer Konsenstheologie einer Dissenstheologie das Wort zu reden. Gewiss, wir sollen die bestehenden Dissense ehrlich benennen, aber dann im geduldigen Zuhören und im Austausch der Argumente die jeweils eigene Position klären, reinigen und vertiefen. Durch einen solchen Austausch der Gaben kann es der Kirche geschenkt werden, die ihr eigene, im ursprünglichen Sinn des Wortes verstandene Katholizität konkret besser und voller zu realisieren. In diesem Sinn ist die ökumenische Theologie ist wie Ökumene insgesamt der Bauplatz der Zukunftsgestalt der Kirche. Das ist es, was mir trotz zeitweiliger Rückschläge an meiner gegenwärtigen Aufgabe Freude bereitet.
V.
Ich möchte schließen mit einer Bemerkung, die der große mittelalterliche Theologe Bonaventura, der ein Zeitgenosse des Thomas von Aquin war, am Anfang seines Sentenzenkommentars macht. Dort nennt er drei Gründe Theologie zu treiben: Primo: Ad confundendum adversarios, um Gegner zu widerlegen. Bonaventura ist dabei gar nicht zimperlich. Er spricht von Schwätzern, Sechsmalgescheiten, Übermütigen, Großmächern und Großmäulern. 2. Ad fovendum infirmos; Theologie soll die im Glauben Schwachen bestärken, nach Bonaventura gehört die Theologie zu den Wohltaten Gottes, der mittels der Theologie unserem schwachen Glauben auf die Beine hilft. 3. Ad delectandum perfectos, um die im Glauben Vollkommenen zu delektieren, d.h. sie zu erfreuen. Denn die Gläubigen – so sagt Bonaventura – staunen und freuen sich, wenn sie verstehen, was sie glauben.
Gute Theologie macht also nicht Glaubensverdruss, sie macht Glaubensfreude. Sie macht nicht humorlos, sondern schenkt Freude an Gott, und die Freude an Gott ist unsere Stärke (Neh 8,10).