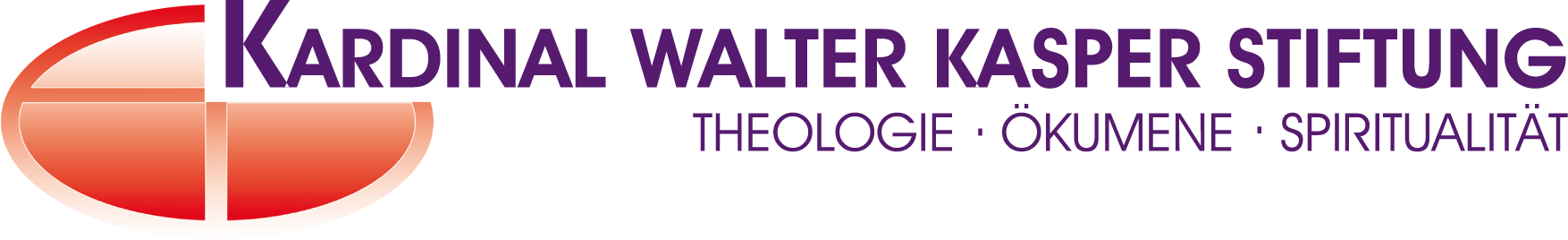Der Dialog zwischen Ost und West
Vortrag von Kardinal Walter Kasper, 23.4.2009 an der Universität Wien
Es gilt das gesprochene Wort.
I.
Der Dialog zwischen Ost und West, näherhin der Dialog innerhalb der einen Kirche in Ost und West, ist ein interessantes und spannendes aber auch ein höchst komplexes Feld. Die Spaltung wie die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft der einen altkirchlichen Ökumene des ersten Jahrtausends läßt sich darum geschichtlich wie theologisch nur dann sinnvoll und einigermaßen erfolgversprechend angehen, wenn man sich zuvor über die ganze Komplexität des Problems Rechenschaft gibt.
Der Dialog zwischen Ost und West beginnt ja nicht erst heute; er hat eine 2000jährige Geschichte, und er führt mitten hinein in die in sich je schon komplexen Beziehungen von Kirche und Imperium bzw. Kirche und Staat, in die Beziehungen von Religion und Kultur, Glaube und Geschichte, Kirche und Neuzeit, Dogma und Spiritualität, mysterienhaft/sakramentale und juristisch/institutionelle Dimension der Kirche. Es wäre darum verkehrt, die Probleme einseitig und isoliert dogmatisch oder einseitig und isoliert politisch anzugehen, so sehr beides bis in die Gegenwart herein eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
Um das Thema, das ohnedies schon komplex genug ist, nicht noch mehr zu komplizieren, beschränke ich mich im folgenden auf das Verhältnis zu den orthodoxen Kirchen byzantinischer, syrisch-antiochenischer und slawischer Tradition; ich verzichte darauf, auch noch auf die Beziehungen zu den orientalisch-orthodoxen Kirchen (Kopten, Syrer, Armenier, Malankara) einzugehen, die sich schon im 5 Jahrhundert zunächst von Byzanz und dann auch von Rom abgespalten haben. Dies wäre ein eigenes und sehr weites Feld, auf dem sich gegenwärtig ebenfalls interessante neuere Entwicklungen abzeichnen.
Die Probleme zwischen Ost und West beginnen jedoch weder erst im 5. und noch weniger erst im 11. Jahrhundert mit dem bekannten Bann von 1054 zwischen dem Patriarchen Caerularius und Kardinal Humbert von Silva Candida; die Spannungen sind vielmehr von Anfang an grundgelegt. Das Ökumenismusdekret des II. Vatikanischen Konzils „Unitatis redintegratio“ stellt zurecht fest, dass das von den Aposteln überkommene Erbe in Ost und West „in verschiedenen Formen und auf verschiedne Weise übernommen und daher von Anfang an in der Kirche hier und dort verschieden ausgelegt worden [ist], wobei auch die Verschiedenheit der Mentalität und der Lebensverhältnisse eine Rolle spielten“ (UR 14). Eine bemerkenswerte und auch zutreffende historische Feststellung!
Ost und West besitzen eine reiche gemeinsame apostolische Tradition: sie teilen die Grunddogmen des christlichen Glaubens, wie er auf den ökumenischen Konzilen des ersten Jahrtausends definiert wurden, sie teilen darüber hinaus – im Unterschied zu den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, welche aus der Reformation des 16. Jahrhunderts direkt oder indirekt hervorgegangen sind – dieselbe apostolische ekklesiale Wesensstruktur. Sie werden darum von uns im theologischen Sinn als Kirchen anerkannt und können als Schwesterkirchen verstanden werden.
Dennoch sind Ost und West schon im ersten Jahrtausend je ihren besonderen Weg gegangen. Nur sehr vereinfacht kann man sagen, dass der Osten mehr metaphysisch-platonisch, der Westen mehr in römischen Ordnungs- und Rechtskategorien gedacht hat. Im Grunde bildeten sich immer mehr zwei unterschiedliche kirchliche Ordnungsvorstellungen aus, das reichskirchliche System in Byzanz, das innerkirchlich mehr auf das Prinzip der Synodalität setzte, und das westliche Ordnungssystem, in dem die petrinische Führungsrolle sich auch deshalb stärker entwickeln konnte, weil im Westen Rom die einzige Kirche war, die sich auf apostolischen Ursprung und dazu hin auf zwei Apostel Petrus und Paulus, berufen konnte.
Das hat schon im ersten Jahrtausend zu vielfältigen Spannungen und auch Schismen geführt. Das akacisischen Schisma hat sogar ganze 35 Jahre gedauert (484-519). Trotzdem konnten die Kirchengemeinschaft zwischen Ost und West bewahrt oder doch immer wieder wiederhergestellt werden, während der Konflikt von 1054, aus dem das Schisma erwuchs, „infolge des Mangels an Verständnis und Liebe füreinander“ (UR 14) his heute nicht mehr aufgehoben werden konnte.
Dabei weiß man spätesten seit Yves Congar (Wo trennten sich Ost und West, 1959) und neuerdings wieder durch Henry Chadwick (East and West. The Making of a Rift in the Church, 2003), dass 1054 mehr eine symbolische Zahl als das exakte Datum eines Schisma zwischen Kirchen ist. Das Schisma ist vielmehr das Ergebnis des langen Prozesses zunehmender Entfremdung, die zu einer akoinonia, zu einer Nichtgemeinschaft geführt hat; die gegenwärtige ökumenische Bemühungen verstehen sich als ein gegenläufiger Prozess der Wiederannäherung und der Versöhnung. Bleibt zu hoffen, dass der Prozess der Wiederannäherung und der Versöhnung nicht ebenso lange dauert wie die Entfremdung und die lange Nacht der Nichtgemeinschaft.
II.
Um die Entfremdung zu überwinden, muss man ihre tieferen Ursachen verstehen. Bei dieser Entfremdung haben neben der nicht zu unterschätzenden Sprachdifferenz und den kulturellen Unterschieden zweifellos politische Faktoren eine erhebliche Rolle gespielt. Während das weströmische Reich bereits im 6. Jahrhundert im Zuge der Völkerwanderung erlöschte, dauerte das byzantinische Reich bis ins 15. Jahrhundert fort. So konnte es in Byzanz vor allem seit Justinian (527-567) zu einem schon dort Eusebius von Caesarea grundgelegten reichskirchlichen System kommen, dessen reichskirchliches Rechtssystem in der Orthodoxie bis heute nachwirkt. Im Westen dagegen hatte der römische Bischof mehr Freiheit, ja das staatliche Vakuum und Chaos drängte ihn sogar in eine eigenständige politische Rolle. So konnte sich die petrinische Tradition frei entfalten. Schon bei Ambrosius, dann bei Papst Gelasius und im frühen Mittelalter vollends bei Gregor VII. wurde die libertas ecclesiae zu einem grundlegenden kirchlichen Handlungsprinzip.
Die Zuwendung zu den Franken und die translatio imperii, die in der Kaiserkrönung Karls d. Gr. im Jahr 800 ihren feierlichen Abschluss fand, musste im Osten unter diesem Umständen als Verrat verstanden werden Sie zeigte andererseits, dass im Westen in der Zwischenzeit durch die Mission der Anglosachsen und der Germanen und später der nordischen Völker und der westlichen Slawen eine eigene neue westliche Ökumene entstanden war und damit eine Welt und eine Kultur, die dem Osten fremd blieb, der aber umgekehrt auch der Osten immer mehr fremd wurde.
Der Osten war zunehmend eingeengt durch das Vordringen des Islam und ist heute geprägt von der Emanzipation vom osmanischen Reich, durch welche es auf dem Balkan und in Griechenland im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zur Bildung von Nationalstaaten und nationalen Patriarchaten kam, eine Entwicklung, die heute auch maßgebende orthodoxe Theologen wie John Meyendorff als problematisch wenn nicht als Fehlentwicklung kritisieren. Durch die Emigration vieler orthodoxer Gläubigen in die westliche Welt (Frankreich, USA, Kanada, Australien u.a.) sind diese Probleme in die Diaspora getragen worden und haben dort zu parallelen und sich überlappenden Jurisdiktionen geführt, die heute dringend nach einer panorthodoxen Lösung verlangen.
Das erste nationale Patriarchat ist das von Moskau (endgültig 1589), dessen Entstehen nach dem Fall von Byzanz oft wiederum im Sinn einer translatio imperii und als Aufkommen eines dritten Rom interpretiert wird. Der Konflikt zwischen Konstantinopel und Moskau um die Führungsrolle innerhalb der Orthodoxie ist also nicht erst jüngern Datums sondern reicht im Grunde bis in die Anfänge zurück. Im Unterschied zu Byzanz teilte Moskau nicht die lange Tradition und Erinnerung einer 1000jährigen gemeinsamen Geschichte mit Rom; es übernahm mit dem Erbe von Byzanz von vorne herein den lang zuvor herangereiften Gegensatz zu Rom. Dieser wurde verschärft durch vielfältige Konflikte zwischen dem sich als orthodoxe Vormacht verstehenden Russland und dem sich als katholischer Vorposten verstehenden westslawischen Polen.
In Russland selbst entstand in der Folge eine reiche religiös-kulturelle Symbiose zwischen Christentum aus byzantinischem Erbe – nicht sehr und nicht allein mit dem jeweiligen russischen Staat – sondern mit dem russischen Geist, der russischen Kultur und dem russischen Volk. Eine zweifellos großartige geistliche literarische, musikalische, künstlerische Kultur. Die russische Orthodoxie ist so gewissermaßen zu einem kulturellen Identitätsmerkmal Russlands geworden und gehört zum kulturellen Selbstverständnis sehr vieler Russen; auch wenn diese sehr oft nicht praktizierend sind, erscheint ihnen doch das westlich-lateinische Christentum als wesensfremd.
Daneben gibt es vor allem seit Peter d. Gr. freilich auch eine westlich orientierte Intelligenzija und in Folge von 70 Jahren atheistischer Propaganda und Erziehung Säkularisierungsprozesse und eine Vielfalt sozialer Probleme (etwa eine negative demographische Entwicklung), deren sich die orthodoxe Führung zunehmend bewusst ist. Deshalb gibt es neuerdings innerhalb der Orthodoxie durchaus Anstrengungen etwa in der Jugend- und Familienpastoral. Sowohl in Russland wie in Griechenland konnte ich feststellen, dass man sich bewusst ist, dass man zumal heute nicht mehr länger nur eine Kirche der Liturgie sein kann.
Man braucht diese vielfältigen Gesichtspunkte, die ich nur andeuten konnte, nur nennen, um zu sehen, dass wir mit dieser Geschichte schon mitten in der Gegenart stehen. Anders als wir Westlicher, die eher unter geschichtlicher Amnesie leiden, lebt die Orthodoxie mehr als wir aus der geschichtlichen Erinnerung. Die Geschichte, und damit auch negative Erfahrungen in der Geschichte (etwa der vierte Kreuzzug mit der Zerstörung Konstantinopel oder das, was sie Uniatismus nennt) sind für sie alles andere als längst vergangene Ereignisse.
Allerdings – und das ist der abschließende positive Gesichtspunkt – befördern die politischen Kräfte und Entwicklungen, die in der Vergangenheit die Spaltung begünstigten, heute eher die Annäherung. Im Rahmen der europäischen Integration verlieren nicht nur Nationalstaaten im Sinn des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts sondern auch nationale Kirchentümer ihre bisherige Bedeutung; andererseits stellen die moderne Säkularisierung wie das Vordringen des Islam alle Kirchen vor ähnliche große neue Herausforderungen und befördern das Bewusstsein, dass sie diesen Herausforderungen nicht im Gegeneinander sondern nur im Miteinander erfolgreich bestehen können. In diesem Sinn ist das Angebot der kulturellen und sozialen Zusammenarbeit sowohl von Konstantinopel und von Moskau wie der pastoralen Zusammenarbeit durch den neuen Erzbischofs von Athen wichtig und zukunftsversprechend. Solche Zusammenarbeit ist noch nicht das Ziel des ökumenischen Weges, kann aber ein Schritt in diese Richtung sein.
III.
Nach dieser langen aber unverzichtbaren Einleitung fragen wir nun, wie sich die heutigen Dialoge zwischen Ost und West in diese Situation einschreiben? Zweifellos – um dies gleich vorneweg zu sagen – kann sich der Dialog nach allem bisher Gesagten nicht auf einen mehr oder weniger akademisch geführten theologischen Dialog beschränken Dieser ist wichtig; erfolgreich kann er aber nur sein, wenn er eingebettet ist in ein Geflecht vor allem von persönlichen Beziehungen, von sozial-kulturellem Austausch und nicht zuletzt von einer Begegnung auf einer tieferen spirituellen Ebene, auf der dem Mönchtum eine nicht zu unterschätzende Rolle zukommt. Das Mönchtum in Ost und West lebt ja aus einer gemeinsamen geistlichen Tradition, wie man aus der Regel des hl. Benedikt leicht entnehmen kann.
Wichtig ist außerdem, dass es seit dem II. Vatikanischen Konzil möglich wurde, wichtige Elemente wieder aufzugreifen, welche im ersten Jahrtausend konstitutive Zeichen der Kirchengemeinschaft waren: Gegenseitiger Austausch von Briefen zwischen den Häuptern der Kirchen vor allem zu Ostern und zu Weihnachten, und gegenseitige Besuche bzw. der Austausch von offiziellen Delegationen. Das sind mehr als protokollarische Höflichkeitsbesuche; das ist Ausdruck von wachsender Kirchengemeinschaft.
Das PCPUC sucht diese Form des Dialogs seinerseits durch gegenseitige Besuche und vor allem durch das CCCC (Comitato cattolico per la cooperazione culturale) zu unterstützen; es wirkt neben der Vergabe von Stipendien (gegenwärtig über 60) durch Unterstützung von Symposien und Übersetzungen von theologischer Literatur). Nach Papst Benedikt XVI. ist das eine unserer wichtigsten Initiativen. Wir werden darin unterstützt von vielen Ortskirchen (nicht zuletzt durch die Erzdiözese Wien in der Tradition von Kardinal Franz König, einem der großen Brückenbauer zwischen Ost und West) und durch die segenreiche Tätigkeit von „Pro Oriente“, für die wir überaus dankbar sind. Auch die Dialoge in Frankreich, Deutschland und besonders in den USA sind hier von großer Bedeutung.
Schaut man nun auf den Dialog im engeren Sinn so muss man zuerst dessen Vorläufer seit dem Pontifikat Leo XIII. und Benedikt XV. wie die beiden Enzykliken des ökumenischen Patriarchen Joachim III. (1902 und 1920) erwähnen. Am Anfang des heutigen Dialogs stehen zwei charismatische Gestalten: Papst Johannes XXIII. und der ökumenische Patriarch Athenagoras. Beide, in ihrer Außerordentlichkeit Glücksfälle der Kirchengeschichte. Auf russisch-orthodoxer Seite muss man Metropolit Nikodim von St. Petersburg nennen, ebenfalls eine außerordentliche Persönlichkeit, der in den Armen von Papst Johannes Paul I. starb. Er war der Mentor des jetzigen Moskauer Patriarchen Kyrill. Auch Kardinal Augustin Bea darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben.
Um das Treffen zwischen Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras in Jerusalem (4./5. Januar 1964) in seiner ganzen Bedeutung würdigen zu können muss man nochmals den Tomos agapis (1971), die Sammlung der damaligen Briefe und Dokumente zwischen Rom und Konstantinopel nachlesen; erst so kann man sich vergegenwärtigen, was für ein historischer Durchbruch dies damals bedeutete. Patriarch Athenagoras sprach die Hoffnung aus, dass nachdem die Christenheit seit Jahrhundert in der Nacht der Trennung lebt und ihre Augen ermüdet sind vom Blick in die Dunkelheit, diese Begegnung die Morgenröte eines lichtvollen und gesegneten Tages sein möge, an dem die künftigen Generationen an demselben Kelch des heiligen Leibes und kostbaren Blutes des Herrn teilnehmen. Papst Paul VI. sprach von vielen Jahrhunderten des Schweigens und der Erwartung. Gemeinsam bekundeten sie ihre feste Absicht, den Willen des Herrn zu erfüllen.
Die ersten Früchte zeigten sich bereits während des II. Vatikanischen Konzils (1962-65). Entscheidend war nicht nur die Anwesendheit orthodoxer Beobachter vielmehr – wie man inzwischen aus den veröffentlichten Konzilsakten weiß – gab es auch direkte Einflüsse der orthodoxen eucharistischen Communio-Ekklesiologie auf die Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ und damit indirekt auf das Ökumenismusdekret „Unitatis redintegratio“.
Aus den Acta synodalia geht hervor, dass die Ansätze der eucharistischen Ekklesiologie in diesen Dokumenten auf die Pariser Schule orthodoxer Exilrussen zurückgeht. Als Vater und Initiator wird Nikolaij Afanasjew genannt, daneben die inzwischen besser bekannten Theologen John Meyendorff und Alexander Schmemann. Inzwischen müsste man den griechisch-orthodoxen Theologen John Zizioulas hinzufügen, der die Position von Afanasjew wesentlich weiterentwickelt und so die eucharistische Ekklesiologie der katholischen Position noch mehr zugänglich gemacht hat. Auf katholischer Seite sind vor allem die Arbeiten von Henri de Lubac, besonders „Corpus Mysticum. L’Eucharistie et l’Église au Moyen Age“ (1949) zu nennen.
Es brauchte nach dem Konzil freilich nochmals fast 20 Jahre bis auf Patmos und Rhodos 1980 der offizielle theologische Dialog eröffnet werden konnte. In der ersten Dialogphase, von 1980-90 ging es zunächst darum, sich zu versichern, dass trotz der langen Trennung die Grundpfeiler der Brücke zwischen Ost und West standgehalten haben. So stellte man die grundlegende Gemeinsamkeit in der Lehre von der Eucharistie, den Sakramenten, dem Priestertum heraus. Bereits im ersten Dokument zeigte sich, dass sich eine gemeinsame Basis im Verständnis der Kirche und ihrer Einheit im Konzept der eucharistischen koinonia/communio gegeben war. Hier begegneten sich eine erneuerte orthodoxe und eine erneuerte katholische Ekklesiologie. Katholischerseits hat vor allem die außerordentliche Bischofssynode von 1985 den Durchbruch der communio-Ekklesiologie gebracht.
Auf dieser Ergebnisse beabsichtigte man bei der Vollversammlung in Valamo (1988) nunmehr die hauptsächlich kontroverse Primatslehre in Angriff zu nehmen. Doch als man sich dann 1991 in Freising traf war durch den Fall der Berliner Mauer und den Zusammenbruch der Sowjetunion eine grundlegend neue Situation entstanden. Die durch das kommunistische Regim als illegal erklärten katholischen Ostkirchen konnten wieder aus den Katakomben hervorkommen und in das öffentliche Leben zurückkehren. Das führte zu Spannungen und Konflikten, anfangs teilweise auch gewalttätiger Art, mit den orthodoxen Kirchen besonders in der Ukraine und in Rumänien. Das Problem des so genannten Uniatismus meldete sich zurück.
Doch nicht nur das, auch das Problem des Proselytismus erstand neu. Vor allem die russische Orthodoxie, damals in einem Schwächzustand und gleichsam am Punkt Null eines Neuanfangs, fühlte sich durch eine – wie sie es sah – mächtige katholische Missionsoffensive bedroht und setzte sich zu Wehr. Das alles führte in Freising (1991) hart an den Rand des Zusammenbruchs des Dialogs.
In Balamand (Libanon) fand man 1993 Formeln, welche den Konflikt auf der praktischen Ebene entschärfen konnten. Es wurde festgehalten, das der sogenannte Uniatismus ein Phänomen der Vergangenheit ist und unter geschichtlichen Bedingungen sich ereignet hat, die nicht mehr die unsrigen sind, dass er unter heutigen politischen und vor allem ökumenischen Voraussetzungen kein Modell mehr für heute und morgen sein kann, dass aber die katholischen Ostkirchen das Recht haben zu existieren und folglich auch sich lebendig zu entfalten.
Leider waren in Balamand nicht alle orthodoxen Kirchen anwesend und nicht alle nahmen nachher das Dokument an, während Papst Johannes Paul II. – wie heute Papst Benedikt XVI. – dieses zwar nicht als volle Lösung so doch als wichtigen Fortschritt anerkannte. So kam das Problem Uniatismus und Proselytismus – wie man vielen Interviews aus Moskau entnehmen kann – bis heute nicht zur Ruhe, trotz der verdienstvollen historischen Arbeit, die „Pro Oriente“ besonders Professor Ernst Christoph Suttner (Staaten und Kirchen in der Völkerwelt des östlichen Europa, 2007) dazu dankenswerter Weise leisteten. Die Vollversammlung in Baltimore (2000) geriet erneut zu einem Fiasko und führte de facto zu einer fünfjährigen Unterbrechung des Dialogs.
Anderes kam hinzu, was von orthodoxer Seite nicht gut angesehen wurde: Der Pastoralbesuch von Papst Johannes Paul II. in der Ukraine und die Errichtung von vier Diözesen auf dem Boden der russischen Föderation, die Verlegung des Sitzes des griechisch-katholischen Großerzbischofs von Lemberg nach Kiew u.a. Umgekehrt findet nicht jede Stellungnahme von orthodoxer Seite eitel Freude in Rom. Das gilt insbesondere von der Praxis der Wiedertaufe in einigen orthodoxen Kirchen, von den Problemen der Restitution von Kirchen in Rumänien und Georgien, von der Verweigerung eines juristischen Status für die kleine katholische Kirche in Griechenland u.a. Was hoffnungsvoll begonnen hatte, schien nun wieder gefährdet.
IV.
Es bedurfte viel Mühe und Geduld, viele formelle und informelle Gespräche in Konstantinopel wie in Moskau, Freundschaftsbesuche bei fast allen orthodoxen Kirchen um das Schiff wieder flott zu machen. Patriarch Bartholomäus aber auch der damalige Metropolit Kyrill, mit dem ich mich mehrfach traf, halfen mit um aus dem Engpass herauszukommen und eine neue Dialogphase zu beginnen. Auch das neue Pontifikat von Papst Benedikt XVI., der als Kenner der Vätertheologie von den orthodoxen Kirchen lebhaft begrüßte wurde und dem das Gespräch mit der Orthodoxie persönlich am Herzen liegt, half ebenfalls ganz entscheidend zu einer neuerlichen Wende zum Positiven.
Nach einem vorbereitenden Gespräch in Rom (2005) konnte der Dialog in Belgrad (2006) und Ravenna (2007) wiederaufgenommen werden, und er wird nach der Vorbereitung auf Kreta (2008) in diesem Herbst auf Zypern weitergeführt werden. Die Gastfreundschaft in Belgrad, auf Kreta und in Ravenna war jeweils überwältigend. Doch auch die zweite Phase ist nicht ohne Wehrmutstropfen. Die russisch-orthodoxe Delegation ist in Ravenna wegen der Teilnahme einer Delegation von Estland abgereist. Da es sich um einen innerorthodoxen Konflikt handelt, konnte ich nicht mehr tun, als beide Seiten eindringlich zu bitten, um der Sache des Dialogs willen doch einen Kompromiss zu finden. Inzwischen hat Konstantinopel den Kompromissvorschlag gemacht, dass in Zukunft nur noch autokephale Kirchen am Dialog teilnehmen sollten, was die estische Frage elegant automatisch lösen würde. Ob und ggf. wie der neue russisch-orthodoxe Patriarch dazu entschieden hat, entzieht sich bisher meiner Kenntnis. Das Prinzip Hoffnung bleibt.
Das Ergebnis des Ravenna-Dokuments „Die ekklesiologischen und kanonischen Folgen des sakramentalen Wesens der Kirche. Kirchliche Gemeinschaft, Konziliarität und Autorität“ ist bekannt. Ein großes Verdienst für das Zustandekommen kommt dem Metropolit von Pergamon, Johannes Zizioulas zu, sicher einer der bedeutendsten gegenwärtigen griechisch-orthodoxen Theologen.
Das Ergebnis stellt einen wichtigen Schritt nach vorne, für beide Seiten aber auch eine Herausforderung dar. Die orthodoxe Seite anerkennt, dass die Kirche auf der lokalen, regionalen und universalen Ebene wirklich ist, und dass auf jeder dieser Ebene gemäß dem berühmten Kanon 34 der Apostolischen Canones (wohl spätes 4. Jahrhundert), also auch auf der universalen Ebene ein Primat (Protos) notwendig ist, wobei der Protos auf der universalen Ebene für die Orthodoxie gemäß altkirchlicher Tradition selbstverständlich der Bischof von Rom ist. Die katholische Seite stimmte zu, dass das Prinzip der Primazialität immer mit dem der Synodalität verbunden ist. Inzwischen haben sich sowohl der Ökumenische Patriarch Bartholomäus wie Papst Benedikt XVI. öffentlich anerkennend über dieses Dokument geäußert.
Konsequent hat sich der Dialog nun der entscheidenden Kontroversfrage zugewandt: „Die Rolle des Bischofs von Rom in der universalen Kirche im ersten Jahrtausend“, also praktisch die Frage des Primats. Im Allgemeinen meint man: Das erste Jahrtausend haben wir gemeinsam, also kehren wir zum ersten Jahrtausend zurück. Doch das ist zu einfach gedacht. Denn 1. ein Jahrtausend ist lang, da gibt es viele Entwicklungen; 2. es gibt unterschiedliche Lesarten und Interpretationen dessen, was man sich in Ost und West unter dem ersten Jahrtausend vorstellt; 3. es gab schon im ersten Jahrtausend in Ost und West unterschiedliche Entwicklungen. So ist uns zwar die Vorstellung von einem Primat des römischen Bischofs gemeinsam; die Frage jedoch, was dies konkret besagt, wurde und wird unterschiedlich beantwortet. Während im Westen vor allem mit Leo d. Gr. im 5. Jahrhundert praktisch schon die volle heutige Primatslehre gegeben ist, findet man Ähnliches bei den östlichen Kirchenvätern nicht oder nur in Ansätzen. Es gibt freilich Brückenbauer wie die lichtvolle Gestalt des Maximos Confessor (580-662), der im Monotheletenstreit zwischen Rom und Byzanz vermittelte.
Immerhin gelang es in Kreta wesentliche Punkte für eine gemeinsame Lesart zu finden und ein brauchbares Papier als Diskussionsgrundlage für Zypern zu entwickeln. Danach ist Rom gemäß den Konzilien von Konstantinopel (381) und Chalkedon (451) die prima sedes; der römische Bischof hat nicht nur einen Ehrenprimat; es werden nicht nur gemäß den bekannten frühen Texten bei Klemens von Rom, Ignatius von Antiochien und Irenäus von Lyon genannt sondern auch anerkannt, dass Rom auch später jeweils entscheidend war für die Bewahrung der nicänischen wie der chalkedonischen Orthodoxie wie für die Überwindung des Ikonoklasmus, der im Osten als Sieg der Orthodoxie gefeiert wird; es wird außerdem im Sinn der Synode von Sardika (343/344) das Appellationsrecht nach Rom und Rom eine Art Berufungsinstanz zuerkannt.
Umstritten ist noch, ob und inwiefern Rom auch von sich aus im Osten eingreifen konnte, wie dies bereits Papst Julius im Jahr 341 im Streit um Athanasius getan hat, als er ihn nach Rom berief, ein Faktum, das dann in das orientalische Kirchenrecht einging und auf dem II. Konzil von Nikaia (787) ausdrücklich festgehalten wurde. Dort wurde festgestellt, dass es für die Anerkennung der Ökumenizität eines Konzils maßgebend ist, dass der römische Bischof mitwirkt (synergein), während bei den anderen Patriarchen von einem zustimmen (symphonein) die Rede ist (H. J. Sieben, Begriff und Kriterien für ökumenische Konzilien, 2009). Wichtig aber bleibt, dass der Primat im Zusammenhang der Synodalität gesehen werden muss. Dieser Text von Kreta könnte eine gute Basis sein für die Diskussion auf Zypern.
Natürlich bleiben viele Fragen offen, und vernünftigerweise kann niemand erwarten, dass wir in Zypern schon alle Probleme lösen können. Die unterschiedlichen Entwicklungen im 2. Jahrtausend bis hin zum I. und II. Vatikanum stehen noch immer wie ein Berg vor uns, und es würde an ein Wunder grenzen, wenn wir diese Barriere bei einem der folgenden Gespräche überwinden könnten.
Erst dann könnte man daran gehen, die Anregung von Papst Johannes Paul II in der Enzyklika „Ut unum sint“ (1995) konkret aufzugreifen und nach einer neuen Form der Ausübung des Primats suchen, welche unter Wahrung der Substanz des Dogmas für beide Seiten akzeptabel ist. Papst Benedikt XVI. hat diese Anregung in seiner Homilie anlässlich seines Besuchs in Konstantinopel am 30. November 2006 wörtlich wiederholt. Sie bleibt also auf der Tagesordnung.
Die Antwort, wie diese Frage konkret gelöst werden kann, bleibt vorerst spekulativ. Oft zitiert man in diesem Zusammenhang die Aussage, die der damalige Professor Joseph Ratzinger 1976 in einem Vortrag in Graz geäußert hat, wonach die Suche nach Einheit mit Maximalforderungen von vorne herein scheitern müsste. „Rom muss vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern, als im ersten jahrtausend formuliert und gelebt wurde“ (Theologische Prinzipienlehre, 1982, 209). Er hat diesen Satz als Kardinal 1987 – nach meiner Meinung zu Recht – differenziert: Die bloße Rückkehr zur alten Kirche ist nach dem Ende der alten Reichskirche und dem Wegfall der Figur des Kaisers kein Weg, auch theologisch nicht; es bedarf eines Wegs nach vorne (Kirche, Ökumene und Politik, 1987, 76 f). Die alte Kirche, vor allem die Zuordnung von Primat und Synodalität kann aber nach wie vor ein Modell sein, das unter den veränderten geschichtlichen Bedingungen des dritten Jahrtausends für die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft maßgebend und hilfreich sein kann.
Ziel kann keine Einheitskirche sein, auch nicht die Übernahme des westlichen Rechtssystems durch den Osten. Bereits das II. Vatikanum hat anerkannt, dass die Ostkirchen das Recht haben, sich nach ihren eigenen Ordnungen zu regieren (UR 16). Das nachkonziliare Kirchenrecht für die katholischen Ostkirchen hat diesen Gesichtspunkt anfanghaft umgesetzt; es sieht beispielsweise vor, dass die Bischöfe der katholischen Ostkirchen nicht vom Papst ernannt sondern von der jeweiligen Synode gewählt werden, woraufhin ihnen der Papst Gemeinschaft gewährt. Diese und andere Reglungen beanspruchen nicht, bereits das Modell für die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft mit den getrennten Ostkirchen zu sein. Sie sind also vorläufiger Natur (OE 30; Apostolischen Konstitution „Sacri Canones“, 1990) (W. Kasper, Die Kirche und ihre Ämter, 2009, 602; 639 f).
Man kann also – wiederum einer Anregung von Joseph Ratzingers folgend – unterscheiden zwischen der geistlichen Funktion des Primats und der administrativen Funktion des Patriarchen. In diesem Sinn ist eine weitestgehende patriarchale Autonomie mit dem Primat Roms vereinbar (Art. Primat, LThK VIII, 1963, 763). An dieser Stelle könnte die Einigungsformel des Konzils von Florenz nochmals von Interesse werden. Das Konzil hatte nach dem Abschnitt mit der Definition des Primats Roms einen weiteren Abschnitt angefügt, welcher die traditionellen Vorrechte der „übrigen Patriarchen“ bekräftigte (Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem) (DS 1307 f).
V.
Natürlich gibt es neben der Primatsfrage noch andere Probleme, die zu lösen sein werden. Vor allem die Frage des Filioque-Zusatzes im Credo stellt für viele Orthodoxe nach wie vor eine Hürde dar. Ich kann auf das dieses Problem hier nicht auch noch eingehen. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Filioque-Problem von orthodoxer Seite u.a. im umfassenderen Kontext der Rezeption bzw. der Nichtrezeption der für den Westen grundlegend gewordenen Theologie Augustins gesehen wird.
Nun hat die neuere westliche Augustinusforschung, etwa bei Roland Kany (Augustins Trinitätsdenken, 2007) zwar gezeigt, dass die übliche Gegenüberstellung von augustinisch/westlicher und kappadokisch/österlicher Trinitätslehre nicht mehr länger zu halten ist; aber ihre Ergebnisse sind bislang im Osten kaum bekannt. So nimmt auch ein so gesprächsoffener Theologe wie Johannes Zizioulas in seinem jüngsten, erst 2006 erschienenen Buch „Communion and Otherness“ gegenüber Augustin eine kritische Haltung ein, die zu meiner Überraschung hinsichtlich des Filioque-Problems auch in den jüngsten anglikanisch-orthodoxen Dialog „The Church of the Triune God (2006) eingegangen ist. Das zeigt nicht nur, dass die Schrift des PCPUC von 1996 „Les traditions grecque et latine concernant la procession du Saint-Esprit“ die Probleme nicht ausräumen konnte, sondern nochmals dass der Einheit bislang noch tiefere theologische Verstehensprobleme im Wege stehen.
Vor allem stellt sich das Problem der Rezeption der Dialog-Dokumente. Dieses Problem reicht weiter als die amtliche Rezeption auf der einen Seite durch die Glaubenskongregation und den Papst und andererseits durch die orthodoxen Synoden; es geht um die Rezeption durch die Kirche insgesamt, also auch durch die Gläubigen, im Osten nicht zuletzt auch durch die Mönche. Das Konzil von Florenz (1439-45) muss uns eine Warnung sein. Die Einigung auf der hierarchischen Ebene wurde damals anschließend durch das darauf nicht vorbereitete Volk verworfen und nach Florenz waren die Dinge schlimmer als zuvor. Ähnlich steht heute vor allem der russisch-orthodoxen Kirche der schmerzliche Riss mit den Altgläubigen noch immer warnend und bremsend vor Augen.
Was können unsere Dialoge also bewirken? Ich denke, sehr viel, aber bei weitem nicht alles. Sie sind aus meiner Sicht eine entfernte Vorbereitung auf ein künftiges, im ursprünglichen Sinn ökumenisches Konzil, das allein die Wiederaufnahme der vollen koinonia/communio beschließen könnte. Wie weit es bis dorthin ist, vermag wohl niemand zu sagen. Wir müssen uns damit begnügen, das zu tun, was wir heute verantwortlich tun können.
Dass es eines Tages dazu kommt, setzt neben der historischen und theologischen Arbeit auf allen Seiten eine tiefe metanoia/conversio voraus. Ohne conversio ist Ökumene und ist vollends ökumenische volle Gemeinschaft nicht möglich. Letztlich ist Ökumene ein geistliches Problem und ein Werk des Hl. Geistes. Ihn kann man nicht herbeizwingen, man soll es auch nicht versuchen, denn gewaltsame Lösungen haben sich bisher immer als kontraproduktiv erwiesen; aber man kann dem Geist vertrauen, dass er das Werk, das er angestoßen hat und das schon so viele gute Früchte getragen hat, eines Tages zu Ende führt.
Die Geduld ist zwar nicht meine besonders hervorragende Tugend. Aber aus dieser Überzeugung heraus vermag ich den mir nunmehr seit zehn Jahren übertragenen Dienst mit all den guten und erfreulichen Erfahrungen mit Freude und trotz manchen weniger guten Erfahrungen und auch Enttäuschungen mit innerer Gelassenheit und vor allem mit Zuversicht zu tun. Der Stiftung „Pro Oriente“ und der Erzdiözese Wien danke ich für ihre tatkräftige Unterstützung bei diesem großen Werk, das für uns alle gemeinsamer geschichtlicher Auftrag ist.