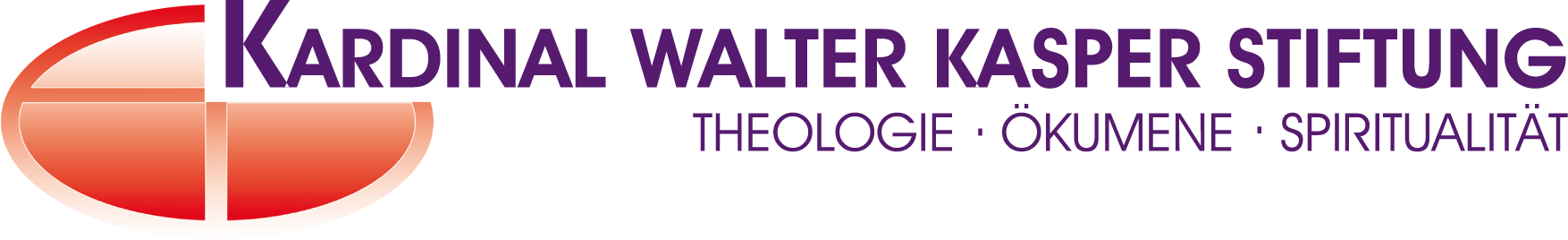Crisis? What Crisis?
98. Deutscher Katholikentag in Mannheim 16.-20. Mai 2012
Die drei Worte „Crisis? What Crisis?“ machen von vorne herein deutlich, dass sich die Krise der Kirche nicht auf einen einzigen Nenner bringen lässt. Sie ist wie die Kirche selbst eine komplexe und vielschichtige Wirklichkeit. Sie hat soziologische und theologische, historische, demographische und viele andere Aspekte, die sich gegenseitig überlagern und bedingen. Ich kann, ohne diese vielfältigen Aspekte in Abrede stellen zu wollen, das Problem nur aus einer, nämlich der theologischen Sicht und auch da in der gebotenen Kürze nur ausschnittsweise und abgekürzt beleuchten.
Auf die Frage „Crisis?“ kann man als Theologe nur mit einem unzweideutigen und klaren Ja antworten. Jesus Christus ist nicht gekommen, damit wir uns in der Welt gemütlich einrichten und es bei allen anderen zu Ansehen bringen. Im Gegenteil, er hat es uns vorausgesagt, dass wir, so wie er selbst, angefochten und verfolgt sein werden. Krise ist für die Kirche Normalzustand. Die Kirche ist immer in Krise. Sie war es in den Christenverfolgungen den ersten Jahrhunderte; sie war es in der Zeit der Reformation, sie war es im Kulturkampf des 19. Jahrhunderts, sie war es im vergangenen 20. Jahrhundert, in dem es mehr Märtyrer gab als in jedem anderen Jahrhundert zuvor, und in dem noch jungen 21. Jahrhundert sind die Christen weltweit die am meisten verfolgte Gruppe.
Die gegenwärtige Kirche in Deutschland dagegen ist eine freie Kirche in einem freien Staat. In der ganzen 2000-jährigen Geschichte war die Kirche nie so frei wie sie es bei uns heute ist, und sie war noch nie rechtlich und wirtschaftlich so gut situiert wie heute, weit besser jedenfalls als alle anderen Ortskirchen in der Welt. Wo also ist die Krise? Besteht sie vielleicht darin, dass wir uns zu gutbürgerlich eingerichtet haben und die wesentliche Krise des Christentums, die Unterscheidung des Christlichen, nicht mehr hinreichend leben? Sind wir vielleicht deshalb uninteressant und langweilig geworden?
Um auf diese Frage zu antworten, muss man klar unterscheiden zwischen der Krise und dem Skandal, der wesentlich zum Christentum gehört und vor dem sich die Kirche, wenn sie denn sich selbst ernst nimmt, nicht drücken darf, und den Krisen und Skandalen, die wir selber verschulden und durch die wir anderen zum Skandalon, zum Anstoß werden. In diesem Sinn war die Aufdeckung von zahlreichen beschämenden Missbrauchsfällen eine Krise, die wir selbst verschuldet haben und die uns sehr viel Vertrauen gekostet hat. Jeder weiß: Einmal verloren gegangenes Vertrauen lässt sich nur schwer und nur in einem längeren ehrlichen und demütigen Prozess wieder zurückgewinnen.
Dass es solche schuldhaften Krisen immer wieder gab und gibt, hat das II. Vatikanische Konzil klar ausgesprochen. In der Pastoralkonstitution rechnet das Konzil den Atheismus zu den ernstesten Gegebenheiten unserer Zeit. Bei der Analyse der Ursachen nennt das Konzil auch „die kritische Reaktion gegen die Religion, und zwar in einigen Ländern vor allem gegen die christliche Religion. Deshalb können an dieser Entstehung des Atheismus die Gläubigen einen erheblichen Anteil haben, insofern man sagen muss, dass sie durch Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch missverständliche Darstellung der Lehre oder auch durch Mängel ihres religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen Lebens das „wahre Antlitz Gottes und der Religion eher verhüllen als offenbaren“ (GS 19).
Mancher mag jetzt denken: Aha, die Gläubigen sind schuld, nicht die Hierarchie! Das wäre unerträgliche klerikalistische Selbstgerechtigkeit und ginge am Sinn der Konzilsaussage vorbei. Denn selbstverständlich zählen auch die Vertreter der Hierarchie zu den Gläubigen; ja, sie haben für den Zustand der Kirche, für alles, was geschieht oder auch nicht geschieht eine besondere Verantwortung. Deshalb hat Papst Johannes Paul II. am ersten Fastensonntag 2000 während eines großen Bußgottesdienstes in St. Peter in Rom durch die jeweils zuständigen Kardinäle ein Schuldbekenntnis der Kirche abgelegt und dafür Gott um Vergebung gebeten:
„für die Schuld durch den Einsatz von Gewalt im Dienst der Wahrheit, für die Spaltungen in der Christenheit, für das den Juden zugefügte Leid, für die verächtliche Behandlung fremder Kulturen und religiöser Traditionen, für die mangelnde Anerkennung der Würde der Frauen, für die Feindschaft gegenüber den Anhängern anderer Religionen und schwächeren gesellschaftlichen Gruppen.“
Damit hat der Papst ernst gemacht, dass zur Kirche, die wir im Credo als die heilige Kirche bekennen, auch Sünder gehören, ja dass es in der Kirche – wie er an anderer Stelle mehrfach gesagt hat – Strukturen der Sünde geben kann und gibt, so dass die Kirche stets der Reinigung bedarf (LG 8). Man kann die Krise also nicht einfach auf die böse Welt abschieben; ebenso wenig kann man für die Fehler einseitig auf die Basis noch einseitig auf „die da oben“ verweisen. Das eine wie das andere ist scheinheilig. Alle sind Volk Gottes und Kirche, alle sind auch Sünder und tragen mit zur Krise bei.
Die Antwort auf die Frage „What Crisis?“ lautet darum: Die Krise besteht nicht in mangelnder Anpassung, sondern in Überanpassung an die Welt und in mangelnder Anpassung an Jesus Christus. Entsprechend war die Rede des Papstes von der Entweltlichung kein Aufruf zum Rückzug aus der Welt, sondern eine Warnung vor Anpassung an die Welt. Entweltlichung ist der Gegensatz zur Verweltlichung. Die Folgerung lautet: Reformen sind notwendig, ja bitter notwendig. Fruchtbar können Reformen aber nur sein, wenn sie aus innerer Erneuerung, aus Umkehr und aus Glaube, Hoffnung und Liebe kommen, und wenn sie die zum Wesen des Christseins gehörende Krise, die Unterschiedenheit und Entschiedenheit des Christseins neu zur Geltung bringen. Äußere Reformen setzen innere Erneuerung voraus wie umgekehrt innere Erneuerung zu sichtbaren und greifbaren Reformen führen muss. Beides gehört zusammen. Im Folgenden möchte ich beide Aspekte, soweit es die begrenzte Zeit erlaubt, etwas konkretisieren.
Zuerst zur Erneuerung. Ich sagte bereits, dass das Konzil den Atheismus zu den ernstesten Gegebenheiten unserer Zeit rechnet. Dieser Atheismus hat viele Gesichter. Das eigentliche Problem ist nicht der aggressive Atheismus des 19. Jahrhunderts, den wir heute im so genannten neuen Atheismus wieder finden, wobei die neuen Atheisten meist nur die Argumente des 19. Jahrhunderts neu aufbereiten. Mit solchen Atheisten kann man immerhin noch streiten Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass für viele die Gottesfrage gar nicht mehr interessant ist, dass sie ihnen gleichgültig ist und sie einfach leben, als ob Gott nicht wäre. Sie haben sich in der Welt eingerichtet, und meinen auch ohne Gott ordentlich durch Leben zu kommen, jedenfalls nicht schlechter als die meisten Christen.
Es gibt freilich auch fromme Atheisten, die man eher als Agnostiker bezeichnen wird, für welche die Gottesfrage unbeantwortbar ist, die aber Menschen sind, die suchen und fragen, Menschen, die wie Pilger unterwegs sind und die spüren, dass durch den Verlust Gottes etwas fehlt in der Welt und im Leben. Wir finden solche fromme Atheisten bei jungen wie bei alten Menschen, bei vielen Künstlern, Wissenschaftlern, Philosophen. Es sind weit mehr solche nachdenkliche Menschen als wir gewöhnlich meinen.
Man hat das schon als Gotteskrise bezeichnet. Damit ist selbstverständlich nicht gemeint, dass Gott in Krise ist, sondern dass wir in Krise sind, weil wir Gott vergessen haben. Denn für die gesamte uns bekannte Menschheits- und Kulturgeschichte war es klar, dass die Ehrfurcht vor dem Göttlichen oder dem Heiligen nicht nur für das Wohl und Heil des Einzelnen, sondern für das öffentliche Wohl und den Frieden grundlegend ist. Auch heute noch ist das die Überzeugung der ganz großen Mehrheit der Menschheit. Unsere säkularisierte Sicht und Lebenspraxis ist ein sehr spätes Phänomen der Kulturgeschichte der Menschheit und bis heute ein Minderheitsphänomen geblieben. Sie ist der tiefste Grund unserer westlichen Kulturkrise und der Schwierigkeit des Christentums, sich in unserer Situation Gehör zu verschaffen und verständlich zu machen. Wir ackern da auf einem verkarsteten und steinigen Boden. Das ist umso schwerer als die Krise – ich wiederhole es – bis tief in die Kirche herein reicht und von uns mit verschuldet ist.
Für die Lösung dieser Krise gibt es keinen Masterplan. Ich jedenfalls habe einen solchen nicht, und allen, die meinen, sie wüssten die Lösung und hätten das Rezept parat, misstraue ich zutiefst. Es ist jedoch offenkundig, dass äußere Reformen allein, wenn sie nicht aus einer Erneuerung aus der Tiefe des Glaubens kommen, auf diese Herausforderung keine Antwort sein können. Die meisten dieser Reformvorschläge sind Insideranliegen und interessieren diejenigen, die draußen sind, herzlich wenig. Die Kirchen, welche die Reformen, die man gewöhnlich anpreist, längst vollzogen haben, die keinen Zölibat und die keine römische Kurie haben, die Frauen ordinieren, die alle zur Kommunion einladen, die Zweit- und Drittehen segnen, stehen kein Haar besser da, im Gegenteil, manche dieser Kirchen brechen über solche Reformen auseinander, sie sind in eine schwere Krise geraten. Diese Krise wünsche ich meiner Kirche nicht.
Selbstverständlich können wir nicht die Flucht zurück und ein roll-back in die vermeintlich gute alte Zeit antreten; wir dürfen aber auch nicht aus Angst die Flucht nach vorne ergreifen, im Sturm vermeintlichen Ballast über Bord werfen, wodurch das leichter gewordene Boot erst recht wie eine Nussschale von den Wellen der rasch wechselnden Moden hin und her geworfen wird. Das wäre nicht Krisenbewältigung, sondern Krisenbeschleunigung. Zum Kairos, d.h. zur Gnadenstunden wird die Krise nur, wenn wir uns auf unsere „Sache“, auf Gott besinnen, wie ihn die Bibel bezeugt und wie er in Jesus Christus und in seiner Herablassung bis ans Kreuz endgültig offenbar geworden ist und durch seine Auferweckung endgültig Zukunft und Hoffnung eröffnet hat.
Er ist weder der rächende, zornige Gott, der uns Menschen klein halten will, noch ist er der harmlose und schwächliche „liebe Gott“, der uns wie ein guter Opa alles durchgehen lässt und uns eben damit in unserer Freiheit und Verantwortung nicht ernst nimmt. Er ist in seiner Barmherzigkeit zugleich der heilige und gerechte Gott. Ohne ihn lässt sich in einer Welt, in der weder Gerechtigkeit und noch weniger die Barmherzigkeit je aufgehen, ein absoluter Sinn des Menschen und der Welt nicht retten. Ohne ihn gibt es keine letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit und Liebe. Das neu zu sagen meint die neue Evangelisierung, und das neu bewusst zu machen erstrebt das Jahr das Glaubens, das in Erinnerung an den Konzilsbeginn vor 50 Jahren am 11. Oktober 2012 beginnt. Ohne solche geistliche Erneuerung laufen alle äußeren Reformen ins Leere; ohne Erneuerung von Glaube, Hoffnung und Liebe sind sie wie ein Strohfeuer, das rasch niederbrennt und verraucht.
Nun zu den Reformen, wenigstens dem Aspekt, der mir besonders wichtig erscheint. Die Kirche ist, wie es uns das II. Vatikanische Konzil neu ins Bewusstsein gerufen hat, Volk Gottes unterwegs. Sie steht auf dem ein für alle Mal von Jesus Christus gelegten Grund; sie ist in allen Jahrhunderten dieselbe, aber in der konkreten sichtbaren Ausprägung ihres bleibenden Wesens ist sie auf den staubigen Straßen der Geschichte unterwegs, um Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen zu teilen (GS 1). Sie ist dieselbe und als solche doch immer wieder neu, frisch und jung. Sie geht immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung (LG 8).
Heute stehen wir mitten in einem solchen geschichtlichen Wandlungsprozess, der, wenn wir gut damit umgehen, ein Erneuerungsprozess werden kann. Wir erleben den größten Umbruch der Kirche in Europa und in Deutschland seit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals brach die Reichskirche in sich zusammen, die immerhin ein ganzes Jahrtausend lang Bestand hatte und den Menschen Heimat gab. Älteste und große Diözesen wie Köln und Mainz, im Südwesten Konstanz, damals die größte Diözese nördlich der Alpen, waren ausgelöscht. Die Seelsorge lag weithin danieder. Aus diesem gewaltigen Umbruch ging eine neue Gestalt der Kirche hervor, nicht mehr die feudale Kirche des Mittelalters und der frühen Neuzeit, sondern die milieugestützte Volkskirche. Sie war nicht mehr vom Adel, sondern vom Volk getragen. Sie hat pastoral und sozial Großartiges geleistet. Sie war krisenfest im Kulturkampf, beim Ende der Monarchie und in den schwierigen Zeiten der Weimarer Demokratie; sie hat das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg überstanden und hat den Neuaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg tatkräftig und erfolgreich mitgestaltet.
Was wir heute als Krise erleben, ist das Ende bzw. das Zu-Ende-gehen dieser Art von Volkskirche. Das tragende christliche und katholische Milieu gibt es nur noch in Restbeständen; unsere Gesellschaft ist religiös und weltanschaulich pluralistisch geworden. Diejenigen, welche sich als Christen bezeichnen und erst recht die sich als Christen bekennen, sind noch ein großen Teil, aber schon heute nicht mehr die Mehrheit. Das Problem wird schon allein aus demographischen Gründen zunehmen. Denn wenn man sich den Altersdurchschnitt der regelmäßigen Kirchenbesucher anschaut, dann wird die Kirche bereits in 10-20 Jahren völlig anders aussehen. Wir stehen erst am Anfang eines gewaltigen Umbruchprozesses.
In diesem Prozess wird schon allein aus demographischen Gründen zunehmend nicht allein der Priester-, sondern ebenso der Gemeindemangel zu Zusammenlegungen von Pfarreien, zur Schließung von Kirchen und kirchlichen Einrichtungen und zu einer neuen, heute sich erst vage abzeichnenden Sozialgestalt der Kirche führen. Das ist ein schwieriger Sterbeprozess und ein nicht weniger schwieriger Geburtsvorgang. Beides, Sterben wie Geburt, sind schmerzliche Vorgänge. Bisher Vertrautes und ohne Zweifel auch viel Wertvolles gehen verloren. Die Krise des Vertrauten und Liebgewonnenen und die Ungewissheit über das noch wenig konkret vor uns stehende Neue lösen verständlicherweise Besorgnisse und Ängste aus und werden von vielen als Zusammenbruch empfunden. Ich kann das nachempfinden, denn ich bin selbst vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, habe den Aufbruch des II. Vatikanischen Konzils bewusst miterlebt und habe mich in der damaligen Gestalt der Volkskirche zu Hause gefühlt.
Ist das ein Grund zur Resignation? Von dem großen Universalhistoriker Arnold J. Toynbee habe ich gelernt, dass es in Krisen- und Umbruchsituationen der Menschheitsgeschichte jeweils nicht die Mehrheit, sondern wache Minderheiten waren, welche einen Ausweg gefunden haben, dem sich die Mehrheit dann anschließen konnte. Minderheiten, wenn sie wache Minderheiten sind, sind keine Sekten. Eine Sekte definiert sich nicht über die Zahl ihrer Mitglieder, sondern über ihr sektiererische, dialogverweigernde in sich verschlossene und nach außen sich hermetisch abschottende Mentalität. Wache Minderheiten dagegen sind nicht Sekte, sondern Vorhut. Das sind Gesichtspunkte, welche schon den Theologen Joseph Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI., sowie andere Theologen vor und neben mir zu der Idee der Zukunft der Kirche als kognitive, kreative und innovative Minderheit geführt haben. Das ist die Gestalt, in welcher die Kirche in vielen anderen Teilen der Welt, in Afrika, Asien wie Lateinamerika längst lebt und sich dabei als jung, lebendig und anziehend erweist. Im Grunde werden wir gegenwärtig auf weltkirchliches Normalmaß gebracht.
Natürlich kann man die neue Gestalt der Kirche nicht am Schreibtisch und am Reißbrett entwerfen und dann von oben per Dekret anordnen. Sie muss wachsen. Soviel kann man aber schon heute sagen: Die neue Gestalt wird sich wieder mehr an der Gestalt der Urkirche und der frühen Christenheit orientieren; sie wird biblisch orientiert und eucharistisch zentriert sein. Sie wird in vielen und vielfältigen kleinen, von Laien getragenen Hauskirchen oder auch Basisgemeinschaften, in Ordensgemeinschaften und geistlichen Gemeinschaften leben, die am Sonntag, dem Tag des Herrn, zur gemeinsamen Feier der Eucharistie zusammenkommen und sich bewusst werden, dass sie in ihrer legitimen Vielfalt der einen größeren, weltweiten katholischen Kirche angehören, in der Priester und Laien zusammenarbeiten. Sie wird keine verschlossene und abweisende Trutzburg sein, sondern innerhalb einer pluralistisch gewordenen Gesellschaft im Austausch mit den anderen Christen, mit den Anhängern anderer Religionen sowie mit allen Menschen guten Willens eine dialogoffene Kirche und in Zusammenarbeit mit ihnen eine diakonische Kirche, die sich der Notleidenden und Bedrängten aller Art annimmt, die sich einmischt und einbringt in den öffentlichen Diskurs um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Eine solche erneuerte Kirche wird wieder neu missionarisch ausstrahlend sein.
Als Papst Johannes XXIII. vor mehr als 50 Jahren das II. Vatikanische Konzil einberufen und vor 50 Jahren eröffnet hat, hat er von einem erneuerten Pfingsten gesprochen. Viele Erneuerungen, für die wir dankbar sein dürfen, sind gekommen. Doch von einem erneuerten Pfingsten, wie es sich viele von uns im ersten nachkonziliaren Enthusiasmus gedacht haben, mag wohl keiner sprechen. Der Hl. Geist kommt nicht immer so, wie wir es gerade gerne hätten; er ist immer für Überraschungen gut. Vielleicht haben wir uns den Aufbruch zu einfach vorgestellt und dabei vergessen, dass die Erneuerung durch innere Umkehr und durch die Erneuerung von Glaube, Hoffnung und Liebe kommen muss. Das erste Pfingsten kam, als die ersten Jünger zusammen mit Maria und den Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, sich im Abendmahlsaal versammelt hatten und um das Kommen des Hl. Geistes gebetet haben. Die Beter werden auch heute die Zukunft der Kirche sein. Sie brauchen wir ganz besonders.
Ich bin überzeugt, wenn wir in der gegenwärtigen dramatischen Situation der Kirche den Mut nicht sinken lassen, sondern allen Mut zusammenzunehmen und mit Gottvertrauen und Realismus des Glaubens die neue Situation annehmen und den schmerzhaften und schwierigen Neuaufbruch in eine neue Epoche wagen, so wie es unsere Väter und Mütter in anderen, ebenfalls schwierigen Krisensituationen der Kirchengeschichte getan haben, dann kann auch aus dieser Krise ein Kairos, eine Gnadenstunde für eine aus dem Glauben erneuerte Gestalt der Kirche werden. Jammern hilft nicht weiter und zieht niemanden an. Freude am Glauben und an der Kirche dagegen wird für viele Suchende und Fragende überzeugend und ansteckend sein. Diesen Aufbruch sollten wir wagen.
Kardinal Walter Kasper, Rom