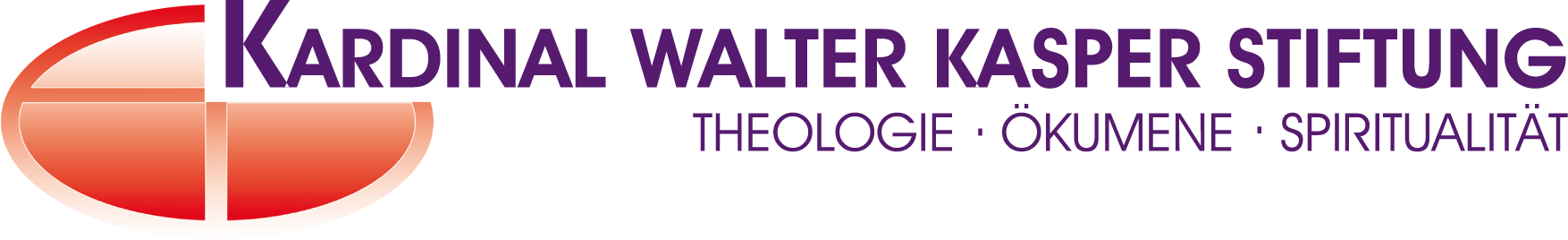Gottesdienst nach katholischem Verständnis
Vortrag im Ulmer Münster am Sonntag, 22. April 2007
Kardinal Walter Kasper.
1. „Gott loben, das ist unser Amt“
In einem bekannten Kirchenlied heißt es: „Gott loben, das ist unser Amt“. Diese Aussage spiegelt ein Thema, das in den Psalmen immer wieder zum Ausdruck kommt ebenso wie in vielen anderen Kirchenliedern, die wir im katholischen wie im evangelischen Gesangbuch gemeinsam haben. Denken wir nur an das den Psalmen nachgedichtete Kirchenlied „Lobet den Herren. Den mächtigen König der Ehren“. Gotteslob und damit Gottesdienst ist unser Amt, d.h. Gotteslob und Gottesdienst sind die Hauptsache in unserem Leben wie im Leben der Kirche. Dazu sind wir geschaffen, dazu sind wir berufen und bestellt, das ist der Sinn unseres Lebens.
Das mag uns Heutigen altmodisch vorkommen. So haben wir uns noch andere, scheinbar modernere Begründungen des Gottesdienstes ausgedacht. Wir sagen etwa: Im Gottesdienst kommen wir zur Ruhe, zur Einkehr, zur Sammlung. Der Gottesdienst tut der Seele gut. Ein gut gestalteter Gottesdienst kann auch ein ästhetisches Erlebnis sein, das die Seele erhebt. Eine Bachkantate oder eine Mozartmesse sind ein solcher erhebender Genuss und eine solche seelische Wohltat. Das alles ist wahr, und das alles tut uns aufgeregten, hektischen Zeitgenossen not.
Beide Begründungen stehen nicht im Widerspruch. Schon der Kirchenvater Irenäus von Lyon sagte: „Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch.“ Anders ausgedrückt: Der Gottesdienst macht menschlich. Er bewahrt uns davor, unter unsere menschliche Würde zu fallen und im Alltag und im Alltäglichen und seinen Banalitäten aufzugehen. Der Gottesdienst zeigt uns und verwirklicht unsere wahre menschliche Würde. Er ist Ausdruck der Freiheit des Christenmenschen.
Der Gottesdienst bewahrt uns ebenso davor, zu Übermenschen zu werden oder zu meinen, wir müssten Übermenschen sein. Er sagt uns, wir sollten nicht meinen wir müssten oder wir könnten unser Leben selber „machen“, wir könnten uns aus uns aus eigener Kraft verwirklichen und unseres eigenen Glückes Schmied sein, wir könnten oder müssten selber Gott spielen und uns anderen gegenüber als „Herrgötter“ aufspielen, gewalttätig gegenüber anderen und rücksichtslos gegenüber der Natur werden.
Wir sind Menschen und nicht Gott. Wir sind darum keine Götter. Wir dürfen uns darum auch nicht selbst zu unserem Götzen machen. Wir haben unser Leben nicht selbst gemacht. Wir verdanken unser Leben einem anderen. Wir haben es letztlich nicht selbst in der Hand. Das sich einzugestehen macht uns erst menschlich. „Gott loben, das ist unser Amt“ ist darum ein Satz von großer menschlicher Weisheit. Er drückt menschliche Größe und zugleich geschöpfliche Demut aus.
Wir Europäer haben diese Weisheit freilich vergessen oder sind in der Gefahr sie zu vergessen. Wir meinen oft, unser menschliches Wohl vom ewigen Heil abkoppeln und auf den Gottesdienst verzichten zu können. Wir meinen leben zu können „etsi Deus non daretur“, „als ob es Gott nicht gäbe“. Wir haben damit in menschheits-geschichtlicher Perspektive einen Sonderweg eingeschlagen, der uns nicht gut bekommen ist. In der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es nämlich keine Kultur ohne Kult. Der Kult ist vielmehr die Seele jeder Kultur.
Inzwischen hat sich der Wind der öffentlichen Meinung etwas gedreht. Es ist viel davon die Rede, und man kann es auf den Feuilletonseiten der großen Zeitungen lesen, die Religion kehre zurück. Bei den letzt jährigen Salzburger Hochschulwochen lautete das Thema: „Gott kehrt zurück.“ Gott ist also, nachdem man ihn längere Zeit als tot erklärt hat, sozusagen wieder salonfähig geworden. Man kann öffentlich wieder von ihm reden. Das ist gut und erfreulich. Ist aber auch eine zweischneidige und zweideutige Sache. Die Frage ist nämlich: Welcher Gott kehrt zurück? Gott oder die Götter bzw. die Götzen? Götzen, die gibt es auch heute. Sie gibt es überall, wo wir an sich gute irdische Werte verabsolutieren. Wo das geschieht, werden sie zu unfrei machenden Idolen.
Immerhin zeigt dier Rede von der Rückkehr der Religion die Aufklärungsresistenz der Religion. Religion ist ein menschliches Grundverhalten, eine anthropologische Konstante. Sie findet sich in allen Kulturen. Überall gibt es Fest und Feier, heilige Orte und Zeiten. Religion ist darum sozusagen nicht tot zu kriegen. Das haben weder die Nazis noch die Kommunisten geschafft, und das schafft auch unsere westliche Wohlstandskultur nicht. Die Wissenschaften können vieles erklären, aber es bleibt ein Rest unaufklärbarer Kontingenz. Wir haben unser Leben letztlich nicht in der Hand und nicht im Griff. Auch der Nichtgläubige spürt das Walten einer höheren Macht, eines Schicksals oder wie immer er das nennen mag. Letztlich bleiben das Dasein und die Welt eine staunenswerte Angelegenheit.
Dieses Staunen, dass ich bin, dass die Welt ist, wird uns durch die modernen Naturwissenschaften nicht abgenommen. Im Gegenteil, die modernen Wissenschaften erschließen uns in einer bisher nicht da gewesenen Weise die Wunder der Natur und ihre Gesetzlichkeiten. Sie können uns darum Anlass sein zum Staunen. Dieses Staunen müssen wir wieder lernen. Es ist die Grundlage der Religion.
Für uns Christen verbirgt sich hinter dem Wunder des Daseins und seines Geheimnisses nicht ein anonymes Geheimnis und ein blindes Schicksal, sondern der persönliche Vatergott, „der Schöpfer des Himmels und der Erde“. Ihn als den einen Gott anzuerkennen und seinen Namen zu heiligen ist das erste und das zweite Gebot. Dieses Gebot ist im Grunde eine Verheißung, eine Zusage. Denn einen Gott zu haben heißt, nicht einem anonymen Schicksal oder einem blinden Zufall ausgeliefert zu sein, bei Gott vielmehr in allen Nöten geborgen zu sein und Zuflucht zu haben. Der Psalm 22 drückt es aus: „Der Herr ist mein Herr und mein Hirt, nichts wird mir mangeln … Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir; dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht“.
Solches Lob Gottes und solche geschöpfliche Demut unterdrückt nicht, sie macht frei. Sie sagt: Ich darf alles gebrauchen, mich an allen Gütern der Schöpfung als Gaben Gottes erfreuen, ich soll mich aber von nichts in Besitz und in Beschlag nehmen lassen. In Besitz und in Beschlag nehmen, das soll mich allein Gott; ihn allein soll ich aus ganzem Herzen und aus allen meinen Kräften lieben (vgl. Mk 12,29f.), alles andere aber insoweit und insofern als es mir den Weg zu Gott nicht versperrt, mich also frei lässt. Eine solche Einstellung gibt Halt, Gewissheit und wahre Lebensfreude, und sie befreit zugleich von der Angst. Sie macht frei und gibt kritischen Abstand. Deshalb gilt das Wort der Liturgie: „Deum servire, regnare est“, „Gott dienen heißt herrschen.“ Der Gottesdienst ist auch der wahre Dienst am Menschen und an seinem Glück.
2. Gottesdienst als Glaubensfeier
Das bisher Gesagte war nur eine Vorüberlegung. Sie wollten zum christlichen Gottesdienst lediglich hinführen. Jetzt kommen wir zur Sache selbst. Denn beim christlichen Gottesdienst geht es nicht um irgendeinen Gott. Es geht nicht um irgendeinen Gottesdienst so wie ihn auch Nichtchristen und die Heiden feiern. Deshalb Vorsicht, wenn man gottesdienstliche Formen aus anderen Religionen übernimmt oder kopiert, wie es heute leider oft gedankenlos geschieht. Im christlichen Glauben geht es um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, um den Gott Jesu Christi, also den Gott der sich in der Geschichte durch Abraham, Mose, die Propheten und abschließend durch Jesus Christus, sein Kreuz und seine Auferstehung als unser Gott und als der eine wahre Gott geoffenbart hat.
Zum jüdisch-christlichen Gottesdienst gehört konstitutiv die Erinnerung: Die Erinnerung an die Berufung Abrahams, an die Erscheinung Gottes am brennenden Dornbusch, an die Offenbarung beim Auszug Israels aus Ägypten und den Durchzug durch das rote Meer, an die Offenbarung am Sinai mit den Zehn Geboten. Schließlich begründet Jesus den christlichen Gottesdienst mit der Aufforderung: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (Lk 24,19; 1 Kor 11,24f.). Im christlichen Gottesdienst geht es also um memoria passionis et resurrectionis Christi, um das Gedächtnis von Tod und Auferstehung Christi.
Die gottesdienstliche Erinnerung ist jedoch nicht nur subjektive Erinnerung, subjektives Gedenken, so wie wir an bestimmten Gedenktagen unserer Eltern oder bestimmter geschichtlicher Ereignisse (Gründung unserer Stadt, Ende des 2. Weltkriegs u.a.) gedenken. Jubiläen zu feiern ist ja wieder modern geworden. Im biblischen Sinn meint Erinnerung (sachar, anamnesis, memoria) objektives Gegenwärtigsetzen durch bestimmte symbolische Zeichenhandlungen. So wird für die Juden bei der Pesachfeier der Auszug aus Ägypten real gegenwärtig. Für uns Christen werden bei der Eucharistiefeier bzw. bei der Feier des Abendmahls Tod und Auferstehung Jesu real gegenwärtig. „Deinen Tod verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“ sagen oder singen wir in der katholischen Liturgie.
Im Gottesdienst feiern wir, was wir glauben. Der Gottesdienst ist Glaubensfeier, gefeierter Glaube. Darum gehört zum Gottesdienst beides: Das Wort, die Lesungen aus der Hl. Schrift und ihre Auslegung in der Predigt, durch welche die vergangene Heilstat im Wort erinnernd gegenwärtig und zu Herzen genommen wird, und die sakramentale Zeichenhandlung, welche die vergangene Tat im Symbol gegenwärtig macht. Ein Gottesdienst ohne Lesung der Hl. Schrift und ohne Predigt ist heute katholischerseits nicht denkbar. Umgekehrt stellen wir dankbar fest, dass im evangelischen Gottesdienst gegenwärtig die sakramentalen Zeichen wieder deutlicher ausgestaltet werden. So ist die frühere Unterscheidung und Gegenüberstellung der evangelischen Kirche als Kirche des Wortes und der katholischen Kirche als Kirche des Sakraments inzwischen obsolet geworden. Jesus sagt ja: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Es geht also um ein Tatgedächtnis, das zugleich Verkündigung ist. „Sooft ihr das tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn“ (1 Kor 11,26). Der Gottesdienst will damit nicht nur den Verstand, sondern den ganzen leibhaftig verfassten Menschen ansprechen.
Noch ein anderer Aspekt ist ökumenisch wichtig. Die Wiederentdeckung des ursprünglichen biblischen Sinns von memoria/Gedächtnis war eine ökumenische Sensation. Im 16. Jahrhundert gab es nämlich zwei besonders hitzige Kontroversen. Die eine ging um die Rechtfertigung allein aus Glauben und in diesem Zusammenhang um die Bedeutung der guten Werke. Bei der anderen ging es um die Messe, die für Luther: „der größte und schrecklichste Gräuel“, eine päpstliche Abgötterei“ war. So fügte er hinzu: „Also sind und bleiben wir ewiglich geschieden und widereinander“ (Schmalkaldische Artikel, 1537). Ähnlich heißt es im reformierten Heidelberger Katechismus (1563) von der Messe, sie sei „eine Verleugnung des einigen (einmaligen) Opfers und Leidens Christi und eine vermaledeite Abgötterei“ (Frage 80).
Warum diese harten Worte? Luther ging es dabei nicht um die Leugnung der realen Gegenwart Christi unter Brot und Wein. Die Lehre von der Realpräsenz verteidigte er vielmehr im Marburger Gespräch mit Zwingli aufs Nachdrücklichste. In dieser Hinsicht besteht mit Luther und den Lutheranern (außer bezüglich der fortdauernden Gegenwart) kein grundsätzliches Problem, wohl aber mit der calvinischen und zwinglianischen Ausprägung der Reformation. Hätten wir heute nur mehr wirkliche Lutheraner, dann wären wir in diesem Punkt ein gutes Stück weiter. Das Problem, das Luther umtrieb, war ein anderes. Er sah in der Lehre von der Messe als Opfer eine Bestreitung und Verleugnung des einmaligen Opfers Jesu Christi auf Golgotha. Es ging ihm also um das Ein-für-alle-Mal und die Allgenügsamkeit des Kreuzesopfers. Das war an sich ein berechtigtes Anliegen, denn die Einmaligkeit des Kreuzesopfers wird von der Bibel nachdrücklich gelehrt (Hebr 9,26f.; 1 Petr 3,18).
Diese Kontroverse ist heute Gott sei Dank im Wesentlichen behoben. Mit Hilfe des biblischen Verständnisses von memoria/Gedächtnis kann man zeigen, dass es bei der Messe nicht um ein neues Opfer oder um die Ergänzung, auch nicht um eine Wiederholung des Kreuzesopfers geht, sondern um die Vergegenwärtigung des ein für alle Mal dargebrachten Opfers Jesu am Kreuz. Diese Vergegenwärtigung geschieht nicht durch uns. Sie ist nicht unser Werk. Sie geschieht im Hl. Geist, den wir in der Epiklese an entscheidender Stelle der Liturgie anrufen und auf die Gaben von Brot und Wein herabrufen. Er ist es, der die Wandlung und die Vergegenwärtigung von Kreuz und Auferstehung vollzieht. Darüber besteht heute ein grundlegender Konsens. Deshalb haben die reformatorischen Kirchen inzwischen erklärt, dass die scharfe Kritik von damals zumindest bezüglich des heutigen katholischen Verständnisses als nicht mehr angemessen angesehen wird. Das ist ein bedeutsamer ökumenischer Fortschritt, den man gar nicht überbewerten kann, für den wir vielmehr von Herzen dankbar sein sollen.
Heute haben wir ein anderes, weithin gemeinsames Problem. Viele wollen die Eucharistie bzw. das Abendmahl nur noch als ein Mahl verstehen und den Opfercharakter auch in dem eben erläuterten Sinn nicht mehr anerkennen, oft meinen sie sogar, ihn nicht mehr ertragen zu können. Das ist schwerlich mit dem biblischen Zeugnis vereinbar. Denn der Opfercharakter ist in den biblischen Abendmahlsberichten eindeutig bezeugt, etwa wenn von dem für uns hingegebenen Leib und dem für uns vergossenen Blut die Rede ist (Mk 14,24; Lk 22,19f. in Anlehnung an Ex 24,8). Durch sein in der Eucharistie vergegenwärtigtes Opfer wird Jesus Christus solidarisch mit den vielen Erschlagenen, Gedemütigten, Ermordeten in der Geschichte bis in unsere Tage. Der Gottesdienst darf diese Realität nicht ausblenden und eine bürgerlich heile Welt vortäuschen. Wenn man daher aus der Eucharistie bzw. aus dem Abendmahl ein bloßes Mahl oder gar eine Art Banquette macht, ist das eine Verharmlosung und Verbürgerlichung, wenn nicht gar eine Banalisierung der Eucharistie. Deshalb habe ich Vorbehalte gegen vieles, was als Feierabendmahl ausgegeben wird. Man darf die Eucharistie nicht um ihren Ernst bringen und aus ihr eine billige Gnade machen (D. Bonhoeffer).
Der Karfreitag führt freilich zu Ostern und kann nur im Licht von Ostern richtig gedeutet werden. Das in der Eucharistie vergegenwärtigte Kreuz ist das österlich verklärte Kreuz. Die Feier der Eucharistie bzw. des Abendmahls sollen darum nicht einem Trauergottesdienst gleichen, sondern einen österlichen festlichen und freudigen Charakter haben. Das Kreuz wird als Hoffnungszeichen gegenwärtig. In dem berühmten Hymnus des Venantius Fortunatus „Vexilla regis prodeunt“ (6. Jahrh.) heißt es: „O Kreuz durch das uns Hoffnung sprießt, in deinem Sieg sei uns gegrüßt.“ Ähnlich beten wir in der Karfreitagsliturgie: „Dein Kreuz o Herr verehren wir, und deine Auferstehung preisen und rühmen wir: Denn siehe durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt.“
Die Anamnese/das Gedächtnis wird so zur Antizipation, die memoria passionis wird zur memoria futuri, zur vorwegnehmenden Erinnerung an die künftige Verklärung. Jeder Gottesdienst ist eine Osterfeier, jeder Sonntag ein kleiner Ostertag. Jede Feier ist ein Fest des Glaubens, ist eine Hoffnungsfeier. Der Gottesdienst kann uns helfen, über das Fürchterliche, das wir jeden Tag in der Welt sehen, im Licht von Kreuz und Auferstehung zu sehen und darüber nicht die Hoffnung zu verlieren. Hoffnung ist heute eine Mangelware geworden. Doch ohne Hoffnung kann niemand leben. So tut uns heute so kleinmütig und defätistisch Gewordenen der Gottesdienst doppelt not.
3. Gottesdienst als Gemeinschaftsfeier (Communio)
Unter einem dritten Gesichtspunkt möchte ich aufzeigen, dass der Gottesdienst nicht nur eine persönliche oder gar eine nur private individuelle Angelegenheit, sondern ein gemeinschaftliches Geschehen ist. Das griechische Wort für Gottesdienst heißt in der Bibel leitourgia; davon kommt unser Wort Liturgie. Leitourgia war in der Antike ein öffentliches Werk zum Wohl des Volkes, das entweder vom Herrscher oder einem reichen Mäzen gesponsert wurde. Die Liturgie ist darum nicht eine private, sondern eine öffentliche Veranstaltung. Sie ist gemeinsamer Gottesdienst, communio.
Dieser Aspekt findet sich auch in der Hl. Schrift. Bei Paulus heißt es: „Wenn ihr zusammenkommt…“ (1 Kor 11,18.20; vgl. 14,26). Auch in der Apostelgeschichte heißt es immer wieder: Sie kamen an ein und demselben Ort zusammen. Gottesdienst meint also Zusammenkommen, Versammlung (synaxis). Auch Kirche (ekklesia) meint als Übersetzung des hebräischen qahal Gemeindeversammlung. Eine solche öffentliche Versammlung läuft nicht einfach spontan, sondern nach einer bestimmten Ordnung und nach festen Formen ab. Schon die biblischen Abendmahlsberichte zeigen Spuren liturgischer Stilisierung.
Man kann die Liturgie also nicht immer wieder neu erfinden und sich nach eigenem Geschmack zusammenbasteln. Ich möchte, wenn ich an einem Gottesdienst teilnehme, nicht den subjektiven Einfällen und Anmutungen des jeweils Zelebrierenden ausgesetzt sein. Ich empfinde das als eine Zumutung. Denn ich komme ja um die Liturgie der Kirche mitzufeiern. In der der Liturgie eigenen Objektivität drückt sich das Universale der katholischen Liturgie aus. Es geht ja um den einen Herrn, um die eine Eucharistie und so um die eine Liturgie. So kann ich überall auf der Welt die Eucharistie mitfeiern oder auch selber zelebrieren. Es ist in vielfältigen Sprachen immer die eine Liturgie. Dass wir alle Brüder und Schwestern in der einen Kirche Jesu Christi sind, ist so nicht nur eine abstrakte Theorie und ein leeres Wort, es ist eine konkret erfahrbare Realität.
Der Gemeinschaftscharakter der Liturgie hat noch eine tiefere Dimension. Nach Paulus gilt: „Wer nehmen alle an dem einen Brote teil, wir bilden alle einen Leib“ (1 Kor 10, 16f.). Der eucharistische Leib Christi verbindet uns zum ekklesialen Leib Christi, zum Leib Christi, der die Kirche ist. Dieses Wort des Apostels hatte eine große Wirkungsgeschichte. Augustinus definierte die Eucharistie als „signum unitatis et vinculum caritatis“, als „Zeichen der Einheit und Band der Liebe.“ Thomas von Aquin konnte sagen: Die eigentliche „Sache“ der Eucharistie sei nicht die Gegenwart Christi und die persönliche Christusbegegnung in der Kommunion, sondern die Einheit der Kirche.
Eine Gemeinde mag im hintersten Winkel der Welt unter weiß Gott für ärmlichen Bedingungen Eucharistie feiern, sie versammelt sich um den einen Herrn und feiert die eine Liturgie, sie tut es darum in Gemeinschaft mit der universalen Kirche, und die universale Kirche tut es in Gemeinschaft mit ihr. Wer Eucharistie feiert ist nie allein. Er gehört zu der einen weltweiten katholischen Kirche. Das sprengt eine engstirnige und bornierte Kirchturmsmentalität und Gemeindeideologie, die meint, die Kirche das sind wir hier, wir definieren, was Kirche ist und was Liturgie sein soll, was andere dazu sagen interessiert uns nicht. Nein, Kirche und Gottesdienst ist etwas Größeres, etwas Weiteres und etwas Universaleres. Es geht immer um den einen Herrn und um die eine Eucharistie. In ihren Gottesdienst ist die Kirche gewissermaßen der älteste „universal player“.
So gehören für uns vom Wesen der Sache her Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft zuinnerst zusammen. Eucharistiegemeinschaft ist Kirchengemeinschaft. Das hat Konsequenzen für die heute viel diskutierte Frage der Eucharistiegemeinschaft. Seit den ersten Jahrhunderten gilt in der Kirche die Regel: Man geht in der Kirche zur Kommunion, zu der man gehört. Das galt bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts auch für die evangelischen Kirchen. Lutheraner und Reformierte (Calviner) hatten darum keine Abendmahlsgemeinschaft miteinander. Die Praxis alle einzuladen ist eine relativ junge Neuerung, die sowohl von der katholischen wie von den orientalischen Kirchen aus Treue zu der biblisch begründeten Tradition nicht mitvollzogen werden kann.
Die daraus entstehenden pastoralen Probleme sind mir selbstverständlich bekannt. Auch ich leide darunter. Wie mit diesen Problemen in pastoral verantwortlicher Weise umzugehen ist, habe ich beim Ulmer Katholikentag vor drei Jahren dargelegt. Ich habe damals gesagt, dass es sich nicht etwa um Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz handeln kann, dass aber jeder allgemeine Grundsatz gemäß den Regeln der Epikie (bzw. oikonomia) und der kanonischen Angemessenheit in rechter Weise angewandt werden muss. Das bedeutet, dass ein Grundsatz gemäß der jeweils einmaligen persönlichen Situation, unter Berücksichtigung der Umstände anzuwenden ist. Das schließt eine allgemeine Einladung aus, ermöglicht aber sofern ein ernsthafter objektiver Grund sowie der eucharistische Glaube und die rechte Disposition gegeben sind, individuelle pastorale Einzelfallregelungen.
Das wird manchmal als unbefriedigend empfunden, und es ist in der Tat unbefriedigend, spiegelt aber das Unbefriedigende der gegenwärtigen ökumenischen Situation, in der keine volle Kirchengemeinschaft besteht. Eine allgemeine und befriedigende Lösung ist deshalb nicht durch Proteste und lautstarke Kritik möglich, sondern nur dadurch, dass man in der Frage der Kirchengemeinschaft zu einer theologisch verantworteten Einigung kommt, dann wäre auch die Frage der Eucharistiegemeinschaft gelöst. Gegenwärtig wird an mehreren ökumenischen Baustellen, sowohl im internationalen und nationalen bilateralen Dialog wie im multilateralen Dialog im Rahmen der Kommission „Glaube und Kirchenverfassung“ des Weltrates der Kirchen an der Kirchen- und Amtsfrage intensiv gearbeitet. Es gab Annäherungen, ein Durchbruch ist uns leider bisher nicht geschenkt worden. Zu meinem Bedauern gab es auch Rückschritte, etwa in dem jüngsten Dokument der VELKD zu Ordination und Beauftragung, das nach unserem Urteil hinter bisher Erreichtes zurückgeht und das sich damit selbst den Boden für die Forderung nach Kommunionsgemeinschaft ein Stück weit entzieht.
Das macht mich traurig, ist für mich jedoch kein Grund zur Resignation, im Gegenteil, es ist ein Impuls und eine Verpflichtung zu einer seriösen ökumenischen Weiterarbeit. Um des Auftrags Jesu Christi willen wie um der Menschen willen gibt es keine verantwortbare Alternative zur Ökumene. Das Ziel der Ökumene ist kein anderes als dass wir uns um den einen Tisch des Herrn versammeln, an dem einen Brot teilnehmen und aus dem einen Kelche trinken und so in Einheit in der Vielfalt volle Gemeinschaft miteinander haben.
4. Gottesdienst und Weltdienst
In einem letzten Abschnitt möchte ich erläutern wie nach katholischem Verständnis der Gottesdienst nicht nur keine rein persönliche Angelegenheit, auch nicht nur eine innerkirchliche Angelegenheit ist, sondern eine ausgesprochene Weltdimension hat. Paulus spricht im Römerbrief von einer logike latreia, d.h. von einem vernunftgemäßen Gottesdienst (Röm 12,1). Er meint damit nicht einen liberal aufgeklärten Gottesdienst. Er spricht vielmehr von einer Erneuerung des Denkens einer Verwandlung des Lebens und der Welt. Es geht also im Gottesdienst nicht um einen Ritus, den man ableistet, sondern um einen Gottesdienst, der Konsequenzen hat und haben muss und der ausstrahlt auf das Leben.
Ausstrahlung auf das Leben bedeutet zunächst Ausstrahlung auf das persönliche Leben. So wie die Rechtfertigung und die Taufe Früchte in Werken der Liebe bringen müssen, so auch der Gottesdienst. Paulus tadelt die Korinther scharf wegen ihrer Parteienstreitigkeiten. „Was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahles mehr!“ (1 Kor 11,19). „Wer unwürdig von dem Brote isst und unwürdig aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn“ (1 Kor 11,27).
Ähnliche Mahnungen finden sich im Jakobusbrief. Dieser tadelt, dass man beim Gottesdienst Unterschiede macht zwischen Reichen und Armen. Er findet es verwerflich, den Reichen die besseren Plätze zu geben, den Armen dagegen die schlechteren Plätze (Jak 2,1-4). Es genügt darum nicht von Brüdern und Schwestern nur zu reden, man muss sich auch entsprechend verhalten. Der Friedengruß, dem wir im Gottesdienst miteinander teilen, darf darum kein bloßer Ritus sein, sonst wäre er eine fromme, oder eher unfromme Lüge. Er muss im Leben der Gemeinde und der Kirche Realität werden.
Damit ist schon deutlich geworden, dass zum Gottesdienst auch soziale Konsequenzen gehören. Schon in der Urkirche fanden aus Anlass der Gottesdienste Kollekten für die Armen in Jerusalem statt. Paulus selbst hat mehrfach dazu aufgerufen. In der Tat, man kann das eucharistische Brot nicht teilen ohne auch das tägliche Brot zu teilen. Eine solche Aussage bedeutet eine ernste Gewissenserforschung für die Gemeinden in den reichen Ländern der Welt bezüglich ihres Verhältnisses zu den Gemeinden in den armen Ländern. Die ungerechte Verteilung der Güter in der Welt geht ja mitten durch die Kirche hindurch, wo es reiche und bitterarme Kirchen gibt. Der christliche Gottesdienst kann hier nicht folgenlos bleiben. Der Gottesdienst erfordert eine Kultur des Teilens und der Solidarität. Er impliziert eine ganze Soziallehre und eine vorrangige Option für die Armen.
Schließlich hat der Gottesdienst auch Ausstrahlung auf unser Verhältnis zur Schöpfung. Brot und Wein, die wir beim Gottesdienst gebrauchen und über die wir die Segensworte Worte der Einsetzung Jesu Christi sprechen, sind Schöpfungsgaben. „Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit“ heißt es in unserer Liturgie. Die eucharistische Danksagung bringt so das Lob der ganzen Schöpfung zum Ausdruck: „Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament“ heißt es in einem der Schöpfungspsalmen (Ps 19,1). Im Lobgesang der drei Männer im Feuerofen wird die ganze Kreatur, Sonne, Mond und Sterne, Regen und Tau, Frost, und Hitze, Eis und Kälte zum Lob Gottes aufgefordert (Dan 3,51ff.) so wie es wieder in dem berühmten Sonnengesang des hl. Franziskus geschieht. Der Zusammenhang geht sogar noch tiefer: Die Verwandlung von Brot und Wein nimmt in einer gewissen Weise etwas voraus von der eschatologischen Verklärung der Schöpfung, wenn Gott „alles in allem“ sein wird (1 Kor 15,28).
Deshalb bezieht gerade die katholische Liturgie alles und alle Sinne ein in die Feier der Liturgie: Licht, Blumen, Farben, besonders die Musik, aber auch den Geruchsinn (Weihrauch), die darstellende Kunst und die Architektur. In der Gabenprozession werden die Gaben der Schöpfung feierlich zum Altar gebracht und gesegnet, an manchen Tagen manches (gesegnetes Brot, gesegneter Wein u.a.) wieder nach Hause genommen und dort verzehrt. Das ganze Leben soll ins Lob Gottes einbezogen werden. Das ist auch der Sinn der Sakramentalien, der sog. kleinen Sakramente, also vor allem gewisser liturgischer Segenshandlungen von Gebäuden, Wohnungen, Brücken u.a.
Das katholische Gottesdienstleben ist darum reich und bunt, anschaulich, farben- und im recht verstandenen Sinn auch lebensfroh. Natürlich kann man solche Bräuche missverstehen und missbrauchen. Aber „abusus non tollit usum“, „Der Missbrauch hebt den Gebrauch nicht auf“. An sich haben alle diese Bräuche nichts mit Magie und dergleichen zu tun. Sie sollen den Glauben und den Gottesdienst ins Leben übersetzen, im Leben der Menschen verwurzeln, heimisch und fruchtbar machen. Um Missverständnisse abzuwehren soll man deshalb statt mit einer blinden Bilderstürmerei zu reagieren diese Handlungen mit einer deutenden Glaubens-verkündigung verbinden, wie es heute allgemein üblich ist und völlig selbstverständlich geschieht. So wird deutlich: Der Glaube ist nicht nur eine Angelegenheit des Kopfes, auch nicht nur des Herzens, sondern eine Sache des ganzen leibhaftigen Menschen.
Noch ein Letztes: In allen diesen Ausdrucksformen liturgischen Lebens kommt neben der Schöpfungsdimension auch die eschatologische Dimension der Liturgie zum Ausdruck. Schon die Urgemeinde feierte ihre Gottesdienste unter eschatologischem Jubel (agallíasis) (Apg 2,46). Überliefert ist der Ruf: Maranatha (1 Kor 16,22; Offb 22,20, Did 10,6). Letztlich vergegenwärtigt die Liturgie, die wir hier auf Erden feiern, die himmlische Liturgie, die Anbetung des Lammes, von der das letzte Buch der Schrift, die Offenbarung des Johannes spricht (Offb 5,8-14; 1 Petr 1,19f.). Man denke etwa an das „Sanctus“, bei dem die Gemeinde in das Dreimalheilig der Engel einstimmt, oder an das „Agnus Dei“, die Einstimmung in die himmlische Anbetung des Lammes. Wir feiern Liturgie in der ganzen Gemeinschaft der Heiligen.
So gehören zur Liturgie – entgegen einer unguten Tendenz die Liturgie nach Art eines Events oder Festivals zu gestalten – Momente der Anbetung, der Stille, der Meditation. Sie tun uns in unserer so lauten und hektischen Welt gut und bilden dazu einen wohltuenden Kontrast und eine heilsame Alternative. Man sage nicht, das komme heute nicht mehr an. Die Gottesdienste der Gemeinschaft von Taizé verzichten ganz auf laute Elemente eines Festivals. Sie sind ganz von meditativen Elementen geprägt; eben deshalb werden sie von vielen Jugendlichen gesucht und geschätzt.
Zum Glück sind wir inzwischen auf einem gutem Weg, die in den letzten Jahrzehnten allzu anspruchslos und manchmal kulturlos gewordene Gestaltung der Liturgie zu überwinden. Gewiss soll man falschen Pomp abbauen. Das darf jedoch nicht zu Kulturlosigkeit führen. Es gilt der inneren Schönheit der Eucharistie durch einen würdigen Vollzug und eine liturgische Kultur Ausdruck zu geben. Letztlich ist Schönheit ein Attribut des Wesens Gottes. Sie meint das, was die Bibel mit Gottes Herrlichkeit (kabod, doxa) bezeichnet. Diese spiegelt sich in der Schönheit der Schöpfung, sie soll sich auch in der Schönheit der Liturgie spiegeln, und sie wird am Ende die gesamte Wirklichkeit verklären.
In der Liturgie tut sich sozusagen ein Spalt auf, der schon jetzt einen Blick in die andere Welt des Himmels erlaubt. Sie kann schon jetzt ein Stück Himmel auf Erden sein. Man denke an unsere himmelstürmenden gotischen Kathedralen und Münster wie hier in Ulm oder an unsere oberschwäbischen Barockkirchen. Nicht umsonst sagt man, dass in Oberschwaben der Himmel etwas tiefer hängt.
Wenn diese Schönheit und Herrlichkeit Gottes in der Feier der Liturgie aufscheint und der Liturgie Glanz verleiht, dann kann vielen Menschen buchstäblich eine neue Welt aufgehen und gleichsam ein Spalt des Fensters in die andere Welt der Transzendenz aufgetan werden. Dann leuchtet in der Liturgie in einer sonst für viele eher grauen und bleiernen Wirklichkeit ein Hoffnungsschimmer auf. Von einer solchen Liturgie geht wie von selbst Faszination aus. Sie wirkt ganz von selbst einladend und anziehend. Sie weckt Staunen, Hoffnung, Freude. Von ihr gilt, was Paulus in einem anderen Zusammenhang sagt: Es werden Außenstehende kommen und sagen: „Wahrhaftig, Gott ist bei euch!“ (1 Kor 14,25).
Vielleicht verstehen wir jetzt ein wenig besser, was es bedeutet: „Gott loben, das ist unser Amt.“ Der hl. Benedikt hat es in seiner Regel so gesagt: „Dem Gottesdienst darf nichts vorgezogen werden.“ Damit ist er zu einem der Gründerväter Europas und der europäischen Kultur geworden. Im Zentrum aller unserer alten Städte stehen Kathedralen oder Münster. Ein Europa ohne Gotteshäuser und ohne Gottesdienst ist nicht denkbar; es wäre nicht mehr Europa. Ohne Gottesdienst werden wir ärmer, mit ihm sind wir reicher. Mit ihm steht und fällt unsere europäische Kultur, steht und fällt die Menschlichkeit unseres Menschseins. Deshalb nochmals der Satz des Irenäus von Lyon: „Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch“.
Es ist das Ziel ökumenischer Bemühung und ökumenischen Gebets, dass wir dieses Zeugnis mit Gottes Hilfe, wann, wie und wo Gott es will gemeinsam geben können. Mit diesem Wunsch machen wir uns das Gebet Jesu am Abend vor seinem Sterben zueigen und übernehmen wir es als sein uns verpflichtendes Testament, „dass alle eins seien, damit die Welt glaube“ (Joh 17,21).