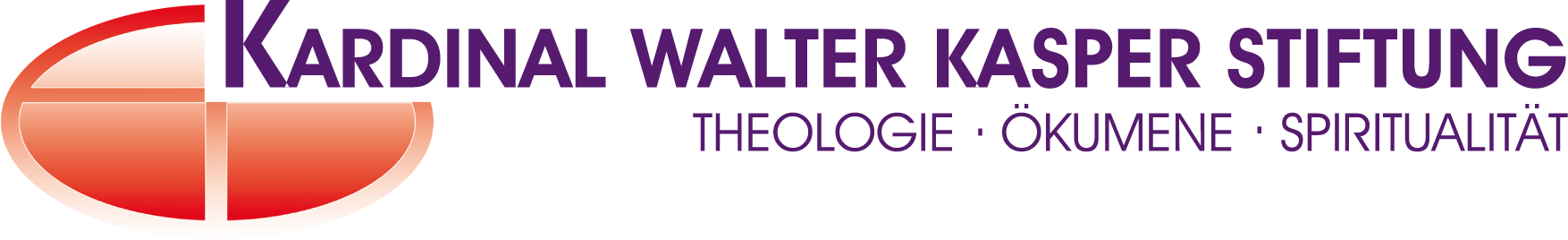Papst Franziskus – Eine Botschaft der Hoffnung für Europa
Kardinal Walter Kasper, Rom
Es ist mir eine Freude und eine Ehre, heute hier im historischen Kaisersaal in Aachen über den diesjährigen Träger des Karlspreises sprechen zu können.
Papst Franziskus bedarf keiner Vorstellung. Er ist nach drei Jahren seines Pontifikats weit über die katholische Kirche hinaus bekannt und geachtet für seine Menschlichkeit und Einfachheit, für seine Botschaft der Barmherzigkeit, für seinen Einsatz für Gerechtigkeit für die Ärmsten der Armen, für den Frieden in der Welt, für die Bewahrung der Schöpfung, für seine Bemühungen zur Erneuerung der Kirche, seinen Einsatz für die Einheit aller Christen und für den Dialog mit anderen Religionen und mit allen Menschen guten Willens.
Als ich nach 1945 als junger Gymnasiast aufgewachsen bin, lag ganz Europa am Boden, Deutschland, nach den Untaten des Hitler-Regimes, nicht nur physisch, sondern auch moralisch. Damals war es für mich und meine Altersgenossen wie eine Erlösung, als weitschauende Politiker vom Format eines Konrad Adenauer, Robert Schuman und Alcide de Gasperi die Idee eines geeinten Europas vortrugen. Aus bisher verfeindeten Völkern sollten Freunde werden und Europa, von dem zwei verheerende Weltkriege ausgegangen waren, sollte zu einer Zone des Friedens in der Welt werden. Nur in einem geeinten Europa konnte Deutschland wieder Ansehen finden und nur ein geeintes Europa konnte in der veränderten Welt neben den beiden aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangenen Großmächten, den Vereinigten Staaten von Amerika und der damaligen Sowjetunion, seinen Part spielen.
Diese Friedensidee wurde zu einer Erfolgsgeschichte. In einer Welt, in der es auch nach 1945 noch viele Kriege gab und leider auch gegenwärtig gibt, wurde Europa eine 70jährige Friedensperiode zuteil, wie wir sie in unserer ganzen Geschichte noch nie hatten. Sie hat uns einen Lebensstandard beschert, von dem unsere Urgroßeltern nicht einmal träumen konnten.
Umso bedrückender ist es, dass dieses Europa heute in einer tiefen Krise steckt. Man hat das Jahr 2016 schon als Schicksalsjahr Europas bezeichnet. Europa und die europäische Solidarität bröckeln. Viele von uns haben es erlebt, wie 1989 die Berliner Mauer fiel und der Zaun zwischen Ungarn und Österreich durchschnitten wurde, um Menschen, die bei uns Zuflucht und Freiheit suchten, Durchlass zu gewähren. Heute baut man wieder Stacheldrahtzäune. Sie waren damals keine Lösung und haben nichts als unsäglich viel menschliches Leid verursacht; und sie tun dies auch heute und sind auch heute keine Lösung.
Europa braucht keine neuen Stacheldrahtzäune. Europa braucht eine Vision, wie es in einer sich rasch verändernden Welt seine europäischen Ideale der Menschenwürde und der Menschenrechte, des Friedens und der Freiheit verwirklichen kann. Dazu braucht Europa eine Stimme, welche mit moralischer Autorität das Feuer der europäischen Idee neu entfachen und einen Weg nach vorne weisen kann. Aber ist es nicht die Armut des gegenwärtigen Europas, dass wir nicht viele solcher Stimmen haben? Papst Franziskus ist eine der wenigen, vielleicht die einzige solche Stimme. Er ist in den drei Jahren seines Pontifikats weit über die katholische Kirche hinaus zu einer moralischen Instanz und zu einem Hoffnungsträger geworden.
Das war – wenn ich richtig sehe – auch der Grund, weshalb man ihn in Aachen als Träger des Karlspreises 2016 vorgeschlagen und gewählt hat, und das war – wenn ich recht verstanden habe – auch der Grund, weshalb der Papst ganz gegen seine sonstige Gewohnheit am Ende doch bereit war, den Karlspreis anzunehmen. Als Bischof von Rom war er sich seiner Verantwortung für Europa in dieser schwierigen Situation bewusst.
Seine Wahl wurde in der Öffentlichkeit mit Überraschung, teilweise auch mit Zurückhaltung und Kritik aufgenommen. Manche Kommentatoren sind der Meinung, Papst Franziskus habe, anders als seine europäischen Vorgänger Paul VI., Johannes Paul II, und Benedikt XVI., mit Karl d. Gr. und dem Europäischen Einigungsprozess bislang wenig zu tun gehabt. Andersherum wird ein Schuh aus diesem Argument. Von außen, von der Peripherie her sieht man die Dinge oft klarer und besser. Dass der Papst von außen als Beobachter die Situation und die Probleme Europas klar sieht und mit innerer Beteiligung verfolgt, haben seine beiden großen Reden in Straßburg vor dem Europäischen Parlament und vor dem Europäischen Rat am 25. November 2014, ebenso wie seither viele andere seiner Reden gezeigt.
Selbstverständlich kann der Papst nicht die politischen und wirtschaftlichen Probleme Europas lösen. Ebenso selbstverständlich kann man humane, ethische und religiöse Zielvorstellung nie eins zu eins in praktische Politik umsetzen. Aber praktische Politik ohne klare Leit- und Zielvorstellungen führt zumal in einer Krise, wie wir sie erleben, zu ziellosem Aktivismus. Zielorientierte Gesinnungsethik und praktische Verantwortungsethik müssen Hand in Hand gehen.
In diesem Sinn kann und wird der Papst ein Wort der Hoffnung und der Ermutigung, wohl auch der Ermahnung sagen. Er wird uns fragen: Europa, wo sind die Ideale, die dich einmal groß gemacht haben, heute?
I. Franziskus – der Papst, der aus der Ferne kommt
Papst Franziskus ist der erste Papst in der fast 2000jährigen Papstgeschichte, der nicht aus dem Bereich des ehemaligen römischen Reiches und, im zweiten Jahrtausend, der erste, der nicht aus dem Bereich des heutigen Europas stammt. Er kommt aus der südlichen Hemisphäre, oder, wie er selber sagte, vom anderen Ende der Welt. Dass es zu dieser Papstwahl kam, zeigt eine kontinentale Erd- und Gewichtsverschiebung in der Welt und in der Kirche. Europa ist politisch und kirchlich nicht mehr das Zentrum des Weltgeschehens. Politisch hat es mit dem Ersten und vor allem dem Zweiten Weltkrieg abgedankt. Kirchlich nimmt das Christentum in Europa ab, im Süden dagegen ist es trotz vielen Wachstumsschwierigkeiten und trotz blutigen Verfolgungen auf Wachstumskurs.
Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur 25% der Katholiken außerhalb Europas lebten, leben heute, 100 Jahre später, nur noch knapp 25% in Europa. Im Laufe von nur einem Jahrhundert hat sich die demographische Pyramide der Kirche komplett auf den Kopf gestellt. Die Kirchen des globalen Südens sind darum selbstbewusster, manchmal auch europakritisch geworden. Die Wahl eines Papstes aus der südlichen Hemisphäre trägt also einer epochalen Gewichtsverlagerung Rechnung.
Die Wahl trägt außerdem der Tatsache Rechnung, dass sich Europa in der globalisierten Welt des dritten Jahrtausends, die zu einem globalen Weltdorf geworden ist, nicht als eine vom Rest des Weltgeschehens abgeschottete Insel der Seligen verstehen kann. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind in die globalen Zusammenhänge und damit auch in die Konflikte der Welt einbezogen.
Zunächst haben wir von der globalisierten Wirtschaft, von den globalen Verkehrsmöglichkeiten, dem globalen Tourismus und von den globalen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten profitiert, teilweise auch auf Kosten anderer Völker. Nun macht uns vor allem die gegenwärtige Flüchtlingskrise die andere Seite der Globalisierung deutlich. Sie zeigt uns, dass die Konflikte und Kriege, die Armut und das Elend anderer Erdteile zu uns durchdringen. Wir können uns deren Konsequenzen nicht bequem entziehen. Es ist bei diesem Zusammenstoßen der Völker und Kulturen ähnlich, wie wenn zwei tektonische Erdplatten unterirdisch aufeinanderstoßen. Wenn dies geschieht, dann löst das gewaltige Erderschütterungen, Erdbeben oder Seebeben mit meterhohen Flutwellen aus. Die Erschütterung alter Sicherheiten sind dann unausweichlich.
So ist die katholische Kirche mit diesem Papst, der aus der Fremde kommt, auf der einen Seite gewissermaßen ein Stück katholischer, d.h. weltweiter geworden. Es ist das Schöne des Lebens in Rom, ganz besonders in diesem Jahr der Barmherzigkeit, täglich Christen aus Afrika, Asien, Lateinamerika zu begegnen und dabei zu erfahren: Wir sind in unserer Kultur verschieden, aber wir haben im christlichen Glauben die gleichen Grundüberzeugungen, wir gehören zur einen Kirche, sozusagen zu einer weltweiten Familie. Umgekehrt hält dieser Papst, der von außen kommt, uns Europäern den Spiegel vor. Er setzt die Probleme der Welt auf die Tagesordnung der bislang vornehmlich europäisch geprägten Kirche. Er sagt uns Europäern, welche geschichtliche Stunde es geschlagen hat und was Menschen, Mitmenschen und sehr oft Mitchristen, also unsere Brüder und Schwestern, von uns als europäischen Christen erwarten und auch erwarten dürfen. Das mag nicht immer angenehm sein, hilfreich ist es allemal.
Europa hat einmal mit seiner Kultur, die auf der Würde jedes und aller Menschen aufbaut, und mit seiner Wissenschaft und Technik die Welt verändert. Darum kann sich Europa heute, wenn es sich nicht selber untreu werden will, nicht zu einer Burg mit aufgezogenen Zugbrücken zurückentwickeln. Wir brauchen eine Vision, wie es weitergehen kann. Das „aggiornamento“ gilt nicht nur für die Kirche, es gilt auch für Europa. Europa muss seine Ursprungsvision erneuern, um einer in einer neuen Weltsituation Zukunft zu haben.
II. Der Papst, der aus Lateinamerika kommt
Für eine solche Wegweisung für das Europa von heute und morgen bringt der Papst, der aus Lateinamerika kommt, eine natürliche Mitgift mit. Seine Muttersprache, das Spanische, ist eine aus dem Lateinischen kommende europäische Sprache (neben dem Englischen die weltweit am meisten verbreitete europäische Sprache). Nicht umsonst spricht man von Lateinamerika und will damit sagen, dass es sich um einen Kontinent handelt, der stark lateinisch und damit europäisch geprägt ist. Das gilt ganz besonders von Buenos Aires, der Geburts- und Heimatsstadt des Papstes und der Stadt, in der er Jahrzehnte als Seelsorger und dann als Erzbischof wirkte. Buenos Aires galt im 19. Jahrhundert als das Paris des Südens, was man den Fassaden im alten Stadtzentrum bis heute deutlich ansieht. Alle älteren, auf die Kolonialzeit zurückgehenden Kirchen sind vom spanischen Barock geprägt. Der Papst hat also europäische Wurzeln. Er nimmt biographisch wie kulturell zwischen Europa und dem Süden der Erdkugel eine Vermittlungs- und Übergangsstellung ein.
Auf der anderen Seite ist Lateinamerika eine von Europa verschiedene Welt mit einer eigenen Kultur, eine Mischkultur (Mestizen-Kultur) mit indigener Bevölkerung, dazu Zuwanderern aus aller Welt, also eine multikulturelle Gesellschaft. Im Unterschied zu vielen heutigen Europäern hat Papst Franziskus darum keine Angst vor Zuwanderen und vor dem Zusammenleben von ethnisch und kulturell unterschiedlichen Volksgruppen. Er hat uns Europäern etwas voraus, das auf uns gegenwärtig erst zukommt.
Die eigene Kultur und die eigene Geschichte Lateinamerikas und besonders Argentiniens sind bei uns viel zu wenig bekannt: Die Eingeborenenkultur (Gauchos, auf Amerikanisch Cowboys, Viehzüchter), dann die spanische Kolonisation, im 19. Jahrhundert die liberale von laizistischen Freimaurern geprägte Entkolonialisierung, darauf die Neubesinnung auf die eigenen kulturellen Wurzeln, teilweise national übersteigert im Peronismus des 20. Jahrhunderts, dann eine Zeit brutaler Militärdiktatur (1976-83) mit tausenden „Verschwundenen“, die in Foltergefängnissen umkamen oder narkotisiert von Flugzeugen über dem Rio della Plata ins Meer geworfen wurden, heute eine Demokratie mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und sozialen Gegensätzen. Also ein Land mit eigener Geschichte, die bei uns kaum oder meist nur schlagwortartig vereinfacht bekannt ist.
Das bedeutet: Dieser Papst passt bei allen europäischen Wurzeln nicht so leicht in unsere europäischen Schemata, vor allem nicht in das seit dem Konzil bei uns vorherrschend gewordene Schema von konservativ und progressiv, von links und rechts. Man darf ihn darum nicht einfach an der Verwirklichung unserer typisch westeuropäischen kirchlichen Reformagenda und unserer Reformwünschen messen. Als Europäer sollten wir vielmehr dankbar sein für die neuen Impulse, die dieser Papst unserem etwas müde gewordenen Kontinent bringt. Wir drehen uns viel zu sehr um uns und unsere Probleme und drehen uns dabei oft im Kreis und schmoren ‚im eigenen Saft‘. Ein Blick über den eigenen Tellerrand tut uns gut.
Eine weitere Mitgift von Papst Franziskus: Er ist der erste Papst, der aus einer Megapolis, einer Megastadt kommt, wie man sie in Europa so nicht kennt. Der Großraum Buenos Aires hat 14 Millionen Einwohner (New York, Mexico City und Sao Paolo haben jeweils 20 Mill., Berlin nur 4 Mill. Rom nur 3 Mill. Einwohner). Im Geschäftszentrum von Buenos Aires gibt es Hochhäuser und Bankentürme, wie man sie aus den USA kennt und wie sie auch in Frankfurt immer mehr hochgezogen werden. Der Papst ist von dieser multikulturellen und multiethnischen Großstadtkultur geprägt. Er kennt und liebt klassische Musik, aber er kennt auch moderne Musik, modernes Theater, moderne Filme und Romane. Er ist ein moderner, urban gebildeter Mann.
Dazu gehört auch die Kenntnis der anderen Seite der lateinamerikanischen Megapolen, die Kenntnis der endlosen Elendsquartiere, die Slums, casas miserias. Jemand sagte: Er wurde im Bauch der ratternden U-Bahn, die in diese Elendsquartiere führt, neu geboren. Was man dort erlebt ist Armut und Elend, Perspektivenlosigkeit, Gewalt und Verbrechen, Drogenhandel, aber auch anrührende Mitmenschlichkeit, Lebensfreude, Sehnsucht nach einem besseren Leben und – nicht zuletzt – einfache, aber tiefe Frömmigkeit. Franziskus ist überzeugt: Wir können von den Armen lernen. Nicht nur sie von uns, auch wir von ihnen. Der Papst aus Lateinamerika hat uns damit etwas zu sagen.
III. Der Papst, der aus der argentinischen Kirche und Theologie kommt
Papst Franziskus und Theologie, da verziehen manche hochnäsig das Gesicht. Ein Journalist hat mir einmal gesagt, Papst Franziskus sei doch nur ein besserer Dorfpfarrer. Manche stellen ihn deshalb kritisch Papst Benedikt XVI. gegenüber, der zweifellos ein Theologe von großem Format ist und der der Kirche mit seinen Predigten, Katechesen und Schriften eine reiches Erbe hinterlässt. Doch als „Theologen-Papst“ ist er in der Papstgeschichte eine zwar erfreuliche, aber auch eine seltene Ausnahme. Die die allerwenigsten Päpste waren professionelle Theologen; die meisten waren Kanonisten, Diplomaten oder Seelsorger.
Papst Franziskus hat auch Theologie doziert und Theologen gefördert. Er ist aber in erster Linie ein Pastor, ein Hirte, ein Seelsorger, ein Spiritual und ein erfahrener Beichtvater, und ein Seelsorger ist er auch als Papst geblieben. Als solcher bringt er reiche menschliche und seelsorgerliche Erfahrung mit. Wenn man Papst Franziskus verstehen will, dann muss man ihn vor allem als Seelsorger sehen.
Das heißt freilich nicht, Franziskus verstehe nichts von Theologie. Mein eigener theologischer Lehrer hat mir beim letzten Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, gesagt: „Wenn Sie etwas verstanden haben, dann können Sie es auch einfach sagen.“ So gesehen hat Franziskus sehr viel verstanden. Er kann komplexe theologische Sachverhalte in allgemein-verständlicher Weise so ausdrücken, dass es jeder versteht.
Will man seine Theologie verstehen, dann muss auch den Jesuiten in Franziskus sehen. Die Jesuiten haben eine lange und gründliche Ausbildung. Die Abkürzung SJ wird oft als Kürzel für „schlaue Jungs“ gedeutet. Ihre Spiritualität ist von den Exerzitien des Ignatius von Loyola geprägt, d.h. von einer biblischen Spiritualität. Sie geht aus von der Betrachtung der konkreten Situation, beurteilt sie dann im Licht der Bibel, kommt dadurch zu einer Unterscheidung der Geister und zu einer persönlichen Entscheidung. Sie geht vor nach dem Motto: Sehen, urteilen, handeln. Wenn bei dieser Entscheidungsfindung im Gebet innerer Friede und innere Ruhe eintritt, dann gilt das als Zeichen des Geistes Gottes. Das ist die Methode, wie Franziskus zu Entscheidungen kommt und wegen der er an einer einmal gefällten Entscheidungen unbeirrt festhält. Mit anderen Worten: Er ist ein Mann, der sich alles genau überlegt, der dann aber auch sehr genau weiß, was er will.
Als Jesuit hat Franziskus seine theologische Ausbildung während und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil durchlaufen. Er ist der erste Papst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65), der beim Konzil selbst nicht dabei war, er ist sogar der erste Papst, der erst nach dem Konzils zum Priester geweiht wurde (1969). Er hat keine vorkonziliare Theologie studiert; er hat die Konzilstheologie sozusagen mit der ‚theologischen Muttermilch‘ aufgesogen. Das Konzil ist ihm nicht etwas, das er wie wir lange ersehnt, hart erarbeitet, endlich erreicht hat und das er nun mühsam erklären und auslegen muss. Das Konzil ist für ihn selbstverständliche Grundlage und Ausgangspunkt seines Denkens und Handelns.
Die Theologie Lateinamerikas hat das Zweite Vatikanische Konzil in eigenständiger Weise weiterentwickelt. Sie knüpfte an der Volks-Gottes-Theologie der Kirchenkonstitution Lumen gentium und an der Verhältnisbestimmung von Kirche und Welt, besonders von Kirche und Kultur in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes, an. Ihre Frage war: Was bedeuten die Volk-Gottes-Theologie und die Verhältnisbestimmung von Kirche und Kultur für uns in Lateinamerika im Kontext von Armut und Unterdrückung?
Dies war die Ausgangsfrage der Theologie der Befreiung. Sie hat in Argentinien jedoch einen besonderen Weg eingeschlagen. Sie ging nicht aus von einer Analyse der sozio-politischen und ökonomischen Verhältnisse und der sozialen Gegensätze, sondern von einer Analyse der gelebten Kultur des Volkes. Natürlich übersieht sie die sozialen Gegensätze nicht, aber sie ist nicht von der Idee des Klassenkampfes, sondern vom Gedanken der Harmonie, des Friedens und der Versöhnung geleitet. Die Stimme des Volkes Gottes, der Glaubenssinn der Gläubigen, der sensus fidelium, ist ihm wichtig. Hinter seiner Volkstümlichkeit steht nicht ein billiger Populismus, sondern vielmehr eine ganze Theologie des Volkes. Darum hat für ihn, anders als in weiten Kreisen der nachkonziliaren europäischen Theologie, die Volksfrömmigkeit vor allem an den großen lateinamerikanischen Marienwallfahrtsorten (Guadeloupe, Aparecida, Luján) einen hohen Stellenwert. Sie ist für ihn geradezu eine Fundgrube (locus theologicus) der Theologie.
Der Papst liefert sich der Volksfrömmigkeit aber nicht kritiklos aus; er weiß dass es in ihr Übertreibungen und auch Vermischung mit paganen Vorstellungen geben kann. Kriterium ist ihm – und das führt zu einem weiteren wichtigen Stichwort – das Evangelium. Damit geht er von einem Zentralbegriff des Neuen Testaments aus. Er ist kein liberaler Reformer, der die Kirche der Welt anpassen will, er ist ein radikaler Reformer, der von der Wurzel (radix) des Evangeliums ausgeht und von dorther die Kirche erneuern will. Er steht in der großen Tradition anderer Kirchenreformer, besonders des Franz von Assisi, der mit seinen Brüdern einfach gemäß dem Evangelium leben wollte. In diesem Sinn fordert Franziskus eine Bekehrung nicht nur des einzelnen Christen, sondern der Kirche, des Klerus, des Episkopat, ja des Papsttums. Bekehrung des Papsttums, das hat meines Wissens bisher noch kein Papst vor ihm gesagt.
Mit dieser Botschaft ist Papst Franziskus kein Revolutionär, sondern ein Erneuerer, der das Wesentliche der Tradition neu zum Glänzen und Leuchten bringen will. Er will von dem Feuer, das Jesus Christus auf die Erde gebracht hat, nicht die Asche weitergeben, sondern die wärmende Glut. Als Lateinamerikaner sieht er, dass die eine Kirche in unterschiedlichen Kulturen lebt und der eine Glaube in den verschiedenen Kulturräumen unterschiedliche Ausdrucksformen finden kann. Die lateinamerikanische, vom Evangelium ausgehende Theologie hat konkrete Konsequenzen für die Reform der Kirche.
Sie hat Konsequenzen auch für die Ökumene. Anfangs haben manche gedacht, was weiß ein Papst aus dem katholischen Lateinamerika schon von der Ökumene? Weit gefehlt! In der multikulturellen Landschaft von Buenos Aires gibt es auch einen Multikonfessionalismus. Schon früh hat Franziskus die Konzeption der Einheit in versöhnter Vielfalt entwickelt und damit bisher verschlossene Türen zu den evangelikalen Pfingstkirchen wie zur russisch-orthodoxen Kirche aufgestoßen. Angesichts der Christenverfolgung in vielen Teilen der Welt spricht er von einer Ökumene des Blutes, welche eine neue ökumenische Antwort erfordert.
IV. Ein Papst mit einer prophetischen sozialen Botschaft
Papst Franziskus blickt über die Kirche hinaus. Er will keine selbstreferentielle, auf sich bezogene, mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigte, in sich verschlossene, sich selbst feiernde oder sich selbst verteidigende Kirche, sondern eine Kirche im Aufbruch, in beständiger Mission bis an die Grenzen der Erde (Mission im weitesten Sinn des Wortes). Er will eine Kirche als Dienst an den Menschen und als Dienst an der Menschheit.
Was ihn vor allem aufgrund seiner lateinamerikanischen Herkunft beschäftigt, ist der himmelschreiende Skandal der Armut in der Welt. Es geht ihm um einen prophetischen Weckruf angesichts von Millionen von Menschen, welche oft nur noch als Problemfälle oder – wie er sagt – als Abfall betrachtet werden. Angesichts dieser Situation kritisiert er eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Dagegen will er seine Stimme erheben. Er beschränkt sich nicht auf abstrakte Grundsätze. Er wird konkret; er spricht prophetisch, d.h. er sagt, was im Licht des Evangeliums hier und jetzt Sache ist.
Diese Aussagen haben teilweise harte Kritik gefunden. Vor allem ist der Satz „Diese Wirtschaft tötet“ auf Widerspruch gestoßen. Man muss den Satz freilich genau lesen. Es heißt nicht „Die Wirtschaft tötet“ sondern „Diese“, d.h. eine bestimmte Art des Wirtschaftens tötet. Gemeint ist nicht die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, wie sie aber in der Weltwirtschaft weithin unbekannt ist. Die Kritik gilt dem entfesselten Kapitalismus mit der absoluten Autonomie der Märkte ohne soziale rechtliche Rahmenordnung.
Selbstverständlich will der Papst keine marktwirtschaftliche Analyse vorlegen. Das ist nicht Aufgabe und nicht Kompetenz eines Papstes. In seiner prophetischen Rede muss er die Situationen freilich konkret benennen. Er stützt sich dabei auf bestimmte empirische Analysen, über die oft Fachleute unterschiedlicher Meinung sind. Für solche Analysen kann und will der Papst keine lehramtliche und schon gar keine unfehlbare Autorität beanspruchen. Man kann und darf als Katholik auch anderer Meinung sein.
Ihm geht es um den grundsätzlichen Systemfehler des kapitalistischen Systems. Die Wirtschaft ist als ein kommunikatives Geschehen nicht nur im Sinn des Warenaustauschs zu verstehen, sondern des Austauschs von Gütern zwischen Menschen. Wirtschaft ist ein zwischenmenschlicher Prozess, bei dem der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Es kann darum nicht nur um Rendite und Gewinn gehen, es muss vielmehr darum gehen, dass alle an den für sie lebensnotwendigen Gütern der Erde, die allen gehören, teilhaben können. Sicher wäre es utopisch, zu meinen, alle könnten gleich viel besitzen. Aber alle sollten so an den gemeinsamen Gütern teilhaben, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen können.
Die soziale Krise ist demnach eine anthropologischen Krise, die dann auftritt, wenn nicht mehr der Mensch, sondern das Geld im Mittelpunkt steht und so zum alles bestimmenden Götzen wird. Deshalb ein vierfaches „Nein“ des Papstes: Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung, in der Menschen an den Rand gedrängt und zum Abfall werden. Nein zu einer Vergötzung des Geldes und zur Ideologie von der absoluten Autonomie der Märkte. Nein zum Geld, das regiert, statt zu dienen. Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt.
Mit dieser vierfachen Kritik steht Franziskus grundsätzlich auf dem Boden der kirchlichen Soziallehre. Er bringt sie in einer konkreten prophetischen Sprache zum Ausdruck. Im ihrem Geist geht es ihm um mehr als um Almosen und um individuelle Nothilfe, um mehr als kirchliche Hilfsorganisationen und Hilfsprogramme, so gut und so segensreich sie im einzelnen Fall sind. Die Kirche muss die strukturellen Ursachen der Armut beheben helfen und zu einem gerechteren Aufbau der Welt beitragen, sie muss eine ganzheitliche Entwicklung fördern. Ein authentischer Glaube schließt immer den tiefen Wunsch ein, die Welt zu verändern, Werte zu übermitteln, nach unserer Erdenwanderung etwas Besseres zu hinterlassen. Ohne solchen Einsatz sind religiöse Übungen unfruchtbar, sie sind leere, heuchlerische Reden.
Dazu gehört: Der Mensch ist nicht nur Empfänger, sondern Subjekt des Wirtschaftsprozesses; er soll durch seine Arbeit aktiver Mitgestalter des wirtschaftlichen Prozesses sein. Die Arbeitslosigkeit vor allem von so vielen Jugendlichen in Ländern des südlichen Europas und der Welt ist darum ein soziales Schlüsselproblem. Zur Würde jedes einzelnen Menschen kommt das Prinzip der Solidarität aller Menschen. Es gilt nicht nur, die Menschenrechte als Rechte Einzelner, sondern auch die Rechte der Völker, besonders der armen Völker, zu achten.
Unter diesem zweiten Gesichtspunkt spricht er ein zweites aktuelles Schlüsselproblem an: Migration und Flucht und die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Gastfreundschaft für Fremde, Notleidende und Verfolgte wird schon im Alten und dann im Neuen Testament als eine grundlegende Pflicht dargestellt. Fremdenfeindlichkeit ist darum für einen Christen ausgeschlossen. Schon Papst Pius XII. hat die Aufnahme von Flüchtlingen als deren Menschenrecht bezeichnet.
Diese kirchliche Soziallehre führt Papst Franziskus unter zwei dem Gesichtspunkten weiter. Ganz auf der schon von Papst Benedikt XVI. vorgezeichneten Linie stellt er die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt. Die Barmherzigkeit ersetzt die Gerechtigkeit nicht. Der barmherzige Blick auf menschliche Not öffnet uns vielmehr erst die Augen für das, was konkret recht und billig ist. Sie ist ein Augenöffner und sie ist zugleich Kraft, nicht nur das Herz, sondern auch die Hände und auch die Füße zu bewegen, um nach Kräften Abhilfe zu schaffen.
Ein zweiter, weiterführender Gesichtspunkt der kirchlichen Soziallehre kommt in der Enzyklika „Laudato sì“ (2015) zum Ausdruck. Dabei geht es nicht um grün eingefärbte Romantik, sondern um eine Wiederentdeckung der oft vergessenen Theologie der Schöpfung. Sie hat als von Gott geschaffe Wirklichkeit ihre eigene Würde; sie soll eine für das Leben der Menschen gedeihliche und erfreuliche Umwelt sein. Der Mensch ist darum als Hüter der Schöpfung eingesetzt. Aber was haben wir aus der Erde gemacht mit Desertifikation des Bodens, Abholzung der Wälder, Vergiftung der Gewässer, Verwüstung der Umwelt, Zerstörung durch Kriege?
Papst Franziskus legt dar, dass die Umweltkrise besonders die Armen belastet. Er fordert darum eine neue Lebenskultur und einen neuen Lebensstil, der nicht vom Haben, sondern vom Geben und Teilen bestimmt ist, eine Kultur der Bescheidung, die vor Zerstreuung bewahrt und den Blick für das Wesentliche neu frei macht. Wie Franz von Assisi im Sonnengesang geht es Franziskus um die Wiederentdeckung der Schönheit als Weg zu Gott.
V. Ein Papst, der Europa Mut macht
In einem letzten Abschnitt möchte ich nun noch über Papst Franziskus und Europa sprechen. Ich weiß nicht, was der Papst bei der Preisverleihung sagen wird. Ich will auch nicht sagen, was der Papst meiner Meinung nach sagen sollte. Ich beziehe mich auf Aussagen, welche der Papst in bisherigen Ansprachen, besonders in seinen beiden Reden in Straßburg, gemacht hat.
Papst Franziskus ist sich des großen Erbes Europas bewusst. Es ist die Idee – wie er es nennt – der transzendenten Würde des Menschen als Person, wie sie in Europa auf der Grundlage der Griechen und Römer in der Geschichte des Christentums entwickelt wurde. Gemeint ist eine Würde, die jedem Menschen als Ebenbild Gottes zukommt, die er sich nicht selbst gibt und die ihm nicht von der Gesellschaft, nicht vom Staat oder einer Partei gegeben wird; sie ist ihm unveräußerlich und unverlierbar eingestiftet. Diese Idee von der personalen Würde des Menschen, jedes Menschen, ist Europas Beitrag zur Weltkultur, sie ist Europas Weltkulturerbe, wobei wir ehrlich hinzufügen müssen, dass diese Würde auch in Europa oft verletzt und mit Füßen getreten wurde. Es gibt die Größe Europa, es gibt auch das Elend und die Schuldgeschichte Europas.
Die Aufgabe, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, stellt sich heute auch mit Blick auf Europa selbst. Die unveräußerliche Würde jedes einzelnen Menschen gilt vom ersten Augenblick seiner Existenz bis zu seinem natürlichen Tod. Zu beidem gibt es in Europa gegenwärtig sehr grundsätzliche Kontroversen und je nach Ländern eine Gesetzgebung, die mit dem christlichen Menschenbild schwerlich vereinbar ist. Die Position des Papstes in diesen Fragen ist eindeutig und klar, und er wird sie wohl auch am bei der Preisverleihung zum Ausdruck bringen.
Es wäre jedoch verengt, die Frage der Achtung und der Würde jedes Menschen nur auf Anfang und Ende des individuellen Lebens zu beziehen. Es stellen sich auch soziale Fragen, die dem Papst besonders am Herzen liegen. Sie stellen sich vor allem in Bezug auf die Weltverantwortung Europas. Die Flüchtlingsfrage und die mangelnde Solidarität Europas ist von Papst Franziskus schon mehrfach kritisch angesprochen worden und er wird das sicher auch am 6. Mai tun. Denn das gegenwärtige Erscheinungsbild Europas ist angesichts der Ideale, für die es steht – vorsichtig formuliert – kein Ruhmesblatt für Europa.
Im Licht der kirchlichen Soziallehre ist Europa auf zwei Pfeiler gebaut: Dem Prinzip der Subsidiarität und dem Prinzip der Solidarität. Subsidiarität bedeutet in diesem Zusammenhang: Jedes Volk hat seine Geschichte, seine Kultur und seine Sprache. Europa kann darum kein Einheitsstaat werden. Es kann und muss nicht alles zentral geregelt werden. Eine zweitweise Regelungswut der Brüsseler Bürokratie hat viele Bürger gegen Europa aufgebacht. Wir müssen unsere Vielfalt nicht als Schwäche, sondern als einen Reichtum begreifen. Zur Subsidiarität kommt die Solidarität, das Zusammenstehen in den gemeinsamen Fragen und Aufgaben. Nur gemeinsam können wir uns in der Welt von heute behaupten; als Einzelne werden wir zum Spielball der großen Mächte. Leider sieht es mit der Solidarität gegenwärtig nicht gut aus. Europa droht im Sumpf nationaler Eigeninteressen und nationalen Egoismen zu versinken.
Dabei weiß der Papst, dass die konstantinische Epoche, die Zeit, da die Kirche der einzige gesellschaftliche Bezugspunkt der Kultur war, vorbei ist. Er spricht klar aus, dass es einer neuen Art der christlichen Präsenz bedarf, in der die Kirche die legitime Laizität anerkennt, d.h. in der Sprache des Zweiten Vatikanischen Konzils die legitime Autonomie der Kultur, der Wissenschaft und des Staates sowie die Religionsfreiheit und eine Pluralität der Kulturen und Religionen. Legitime Laizität – das hat schon Papst Benedikt XVI. herausgestellt – hat nichts mit einem Laizismus zu tun, der die Religion aus der Öffentlichkeit verbannen will. Legitime Laizität will ein positives, konstruktives Verhältnis des Dialogs, der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Bereicherung der Religionen und Kulturen.
Um die neue Art christlicher Präsenz zu verdeutlichen greift Papst Franziskus auf einen für ihn charakteristischen prozesshaften Denkansatz zurück. Die europäische Kultur und Friedensordnung ist keine statische, ein für alle Mal erreichte Größe, die man durch Restauration einer früheren Gestalt Europas erreichen kann, etwa mit der Idee des hl. Römischen Reiches, wie es bei Karl d.Gr. grundgelegt und dann bei den Ottonen, Salinger und Staufern verwirklicht wurde, oder der Idee eines idealisierten mittelalterlichen Europas, wie es Novalis (Die Christenheit oder Europa, 1799) oder zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg manchem Vertreter der Idee eines neuen Abendlands vorschwebte. Die europäische Idee muss in einem immer wieder neuen Bemühen verwirklicht werden. Um das Gut des Friedens zu gewinnen, darf man nicht von einer Friedensordnung ausgehen, welche anders Denkende und anders Lebende auszugrenzen, sondern sie einzubeziehen sucht.
Der Papst nennt dafür zwei grundlegende Begriffe: Multipolarität und Transversalität. Mit der Multipolarität plädierte er für ein Europa der Einheit in der Verschiedenheit, welche hegemoniale Vormachtstellung ausschließt und die kulturelle Verschiedenheit achtet. Die Transversalität meint einen offenen, respektvollen und bereichernden Austausch zwischen den Generationen, zwischen Menschen und Gruppen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher ethnischer, sprachlicher und religiöser Tradition in einem Geist gegenseitigen Verständnisses und gegenseitiger Achtung. In dieser transversalen Kommunikation kann das Christentum heute neu seinen Platz finden.
Im Grunde hatte Europa von Anfang an eine solche transversale kommunikative Identität. Es hat im Laufe seiner Geschichte jüdische, griechisch-byzantinische, römische, keltische, germanische, slawische und auch arabisch-islamische Elemente der Kultur in sich aufgenommen und sich in kritisch-konstruktiver Weise angeeignet. Schon Karl d. Gr. hat hier in Aachen islamische Delegationen empfangen und war mit ihnen im Austausch. So tut sich nach dem Ende der alten eurozentrischen Welt und des konstantinischen Zeitalters mit seiner Symbiose von Kirche und weltlicher Macht und Kultur ein Weg auf in eine neue Zeitepoche. Das Wort von der Krise Europas hat darum in diesem wie in anderem Zusammenhang einen doppelten Sinn: Infragestellung eines alten Zustands, aber auch Kairos, Gnadenstunde als neue Chance, Anfang und Neugeburt einer neuen Zeit.
Europa macht auf den Papst einen müden Eindruck. Die großen Ideale, die Europa inspiriert haben, scheinen ihm ihre Anziehungskraft verloren zu haben. So schloss der Papst in Straßburg mit einem aufrüttelnden Appell: „Es ist der Moment gekommen, den Gedanken eines verängstigten und in sich selbst verkrümmten Europas fallen zu lassen, um ein Europa zu erwecken und zu fördern, das ein Protagonist ist und Träger von Wissenschaft, Kunst, Musik, menschlichen Werten und auch Träger des Glaubens. Das Europa, das den Himmel betrachtet und Ideale verfolgt; das Europa, das auf den Menschen schaut, ihn verteidigt und schützt; das Europa, das auf sicherem, festem Boden voranschreitet, ein kostbarer Bezugspunkt für die gesamte Menschheit!“
Diese Mut machende Botschaft braucht Europa. Wir dürfen darum auf den 6. Mai gespannt sein. Wir dürfen hoffen: Es wird ein guter Tag sein für Europa, seinen Zusammenhalt und seine Zukunft, ein guter Tag besonders für die jungen Menschen, denn sie sind die Zukunft Europas, ein guter Tag für alle, die in Europa Hilfe brauchen und die von Europa Hilfe erwarten, ein Tag, der uns klar macht: Europa hat nicht ausgedient. Europa hat auch in Zukunft eine Aufgabe in der Welt. Es kommt auf uns an, sie anzupacken. So kann der 6. Mai ein Tag werden mit einer Botschaft der Hoffnung für Europa.