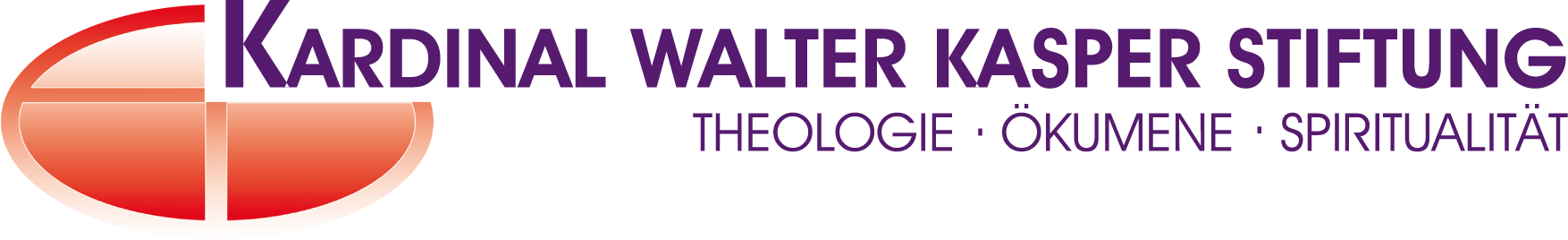Wandel der ökumenischen Situation
Kardinal Walter Kasper
Es ist mir eine angenehme Pflicht der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und ihrer Katholisch-theologischen Fakultät mit dem Glückwunsch zu ihrem Jubiläum meinen Dank auszusprechen für die Auszeichnung durch die Verleihung eines Doktors honoris causa. Ich danke für die freundlichen Grußworte des Herrn Erzbischofs Dr. Zollitsch, des Herrn Rektors der Universität, Professor Dr. Jäger, des Herrn Dekan Professor Dr. Hoping und besonders für die Laudatio von Herrn Professor Dr. Peter Walter.
I.
Es ist ein besonderes Gefühl, wenn ich heute nach 18-jähriger Unterbrechung wieder in einen Hörsaal zurückkehre, was 25 Jahre lang fast täglich mein Geschäft war. Es war nicht die schlechteste Zeit meines Lebens. War es damals das Fach Dogmatik so ist mir inzwischen die Ökumene und damit die ökumenische Theologie als Aufgabe zugefallen. Das ist ein spannendes und vor allem ein weites Feld. Es reicht vom Gespräch mit der Assyrischen Kirche des Ostens und den Orientalisch orthodoxen Kirchen, mit den orthodoxen Kirchen byzantinischer wie slawischer Tradition, der Anglikanischen Gemeinschaft, den Altkatholiken, Lutheranern und Reformierten, den Freikirchen bis zu den im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert in enormem Wachstum begriffenen evangelikalen und pentekostalen Gemeinschaften. Dabei habe ich die Aufgabe der Förderung des ökumenischen Anliegens in der eigenen, der katholischen Kirche noch gar nicht erwähnt.
In möchte in diesem Zusammenhang nicht auf die bekannten theologischen Grundlagen der Ökumene eingehen, sondern mit einigen Streiflichtern etwas zum aktuellen Strand und d.h. zum rasanten Wandel der ökumenischen Situation sagen. Wandel ist zunächst in dem positiven Sinn gemeint, dass wir in den letzten mehr als 40 Jahren seit dem II. Vatikanischen Konzil mit fast allen genannten Kirchen ein gutes und freundschaftliches Klima des Dialogs und der praktischen Zusammenarbeit herstellen konnten. Wandel meint aber auch, dass sich die Koordinaten der ökumenischen Szene in einem grundlegenden, noch längst nicht abgeschlossenen Wandel befinden, der dem Wandel in der Welt von heute in praktisch allen Lebensbereichen entspricht.
II.
Man beschreibt diesen Wandel gewöhnlich mit dem Stichwort „Globalisierung“. Sie wurde nach dem Ende des Blockdenkens während des Kalten Kriegs möglich und hat dazu geführt, dass Ost- und Westeuropa heute in einem schwierigen Prozess wieder zusammenwachsen. Dadurch sind die Ostkirchen ganz neu ins Blickfeld getreten. Noch mehr, die Integration von West- und Osteuropa ist ohne die Annäherung mit den Ostkirchen, welche die osteuropäische Kultur und Mentalität über Jahrhunderte entscheidend geprägt haben, gar nicht möglich. Dazu kommt, dass aufgrund der Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert ungefähr die Hälfte der orientalischen Christen in der westlichen Welt leben. Auch damit ist eine neue, bisher nicht da gewesene Dialogsituation gegeben.
Der Dialog mit den Ostkirchen nahm am Vorabend des Konzilsabschlusses, am 7. Dezember 1965, einen verheißungsvollen Anfang mit der (so genannten) Aufhebung der Bannbullen von 1054, dem Jahr, mit dem man das Ost-West-Schisma mehr symbolisch als historisch verbindet. In die zweite Hälfte der 60er Jahre gehört auch der Briefwechsel zwischen Papst Paul VI. und dem Ökumenischen Patriarchen Athenagoras, der in einem Band gesammelt vorliegt, der den bezeichnenden Titel „Tomos agapes“ (Band der Liebe) trägt (1971). Im Zusammenhang des verheißungsvollen Anfangs mit dem „Dialog der Liebe“ stehen die vielen gegenseitigen Besuche zwischen Papst Johannes Paul II. und fast allen ostkirchlichen Patriarchen.
Für den theologischen Dialog im engeren Sinn hatte das II. Vatikanische Konzil gute Grundlagen geschaffen. Es hatte von den Ostkirchen wohlwollend gesagt, dass die „verschiedenartigen theologischen Formeln oft mehr von einer gegenseitigen Ergänzung als von einer Gegensätzlichkeit sprechen“. Auf dieser Grundlage konnte der theologische Dialog in den 80er Jahren hoffnungsvoll beginnen. Paradoxerweise stürzte jedoch die politische Wende in Ost- und Mitteleuropa von 1989/90 den theologischen Dialog in eine tiefe Krise. Die Freiheit von der kommunistischen Zwangsherrschaft ermöglichte es nämlich den mit Rom unierten Ostkirchen, die unter dem Kommunismus unsäglich gelitten hatten, aus den Katakomben herauszukommen und ins öffentliche Leben zurückzukehren. Damit brachen alte Wunden und neue Verwerfungen auf.
Das Balamand-Statement (1993) brachte einen als historisch zu bezeichnenden Durchbruch, als man aber 2000 in Baltimore-Emmitsburg versuchte, das auf der praktischen Ebene Erreichte ekklesiologisch zu vertiefen, kam es zum Scheitern. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit um die orthodoxen Kirchen davon zu überzeugen, dass die Fragen des so genannten Uniatismus nur in dem größeren Zusammenhang der Ekklesiologie, besonders des Petrusamtes gelöst werden können.
Erst im September 2006 war in Belgrad ein Neuanfang möglich, den wir im Oktober dieses Jahres in Ravenna, einem für das Verhältnis zum byzantinischen Osten symbolischen Ort, weiterführen wollen. Es ist die Absicht, den Boden zu bereiten, auf dem dann das entscheidende Problem zwischen den Ostkirchen und der lateinischen Kirche, die Frage des Primats Roms, angegangen werden kann. Das soll dadurch geschehen, dass der berühmte Kanon 34 der aus dem 4. Jahrhundert stammenden Apostolischen Canones in der Weise ausgelegt wird, daß auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens – auf der Ebene der Ortskirche, der Region bzw. des Patriarchats wie auf der universalen Ebene – ein komplementäres Spannungsverhältnis besteht zwischen einem Protos, d.h. einem Primas und kollegialen bzw. synodalen Strukturen. Auf dieser Grundlage soll dann in einem weiteren Schritt die Stellung des Primas auf der universalen Ebene besprochen werden.
Papst Johannes Paul II. hat einen ersten Schritt getan, als er in der Ökumeneenzyklika „Ut unum sint“ (1995) zu einem Dialog über neue Formen der Ausübung des Petrusamtes eingeladen hat. Papst Benedikt XVI. hat dieses Angebot bei seinem Besuch im Fanar im November des vergangenen Jahres wörtlich wiederholt. Die Tatsache, dass die katholische Kirche schon heute zwei unterschiedliche Rechtsbücher besitzt, eines für den Bereich der lateinischen Kirche und eines für den Bereich der mit Rom in voller Gemeinschaft stehenden Ostkirchen, zeigt, daß der Primat in Ost und West in unterschiedlicher Weise ausgeübt werden kann. Das war im ersten Jahrtausend so und das kann im dritten Jahrtausend wieder so sein.
Immer wieder wird dabei auf die Regel verwiesen, die der damalige Professor Ratzinger in seinem berühmten Grazer Vortrag 1976 formuliert hatte, wonach Rom von den orthodoxen Kirchen nicht mehr an Primatslehre verlangen muss als im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde. Der frühere Kardinal Ratzinger hat diese Regel später etwas relativiert, wie mir scheint zu Recht; denn es gab im ersten Jahrtausend keine einheitliche Praxis, sondern unterschiedliche Entwicklungen und Tendenzen, auch zahlreiche Schismen. Das erste Jahrtausend gibt uns daher kein Rezept an die Hand, sondern verweist auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt in der altkirchlichen communio-Ekklesiologie. Ein Zurück ins erste Jahrtausend ist auch deshalb nicht möglich, weil die damalige Praxis eng mit dem römisch/ byzantinischen Reichsrecht verknüpft war, das heute Geschichte ist.
So stellen sich im Detail schwierige exegetische, historische, kanonistische und systematisch-theologische Fragen, auf die ich in diesem Zusammenhang unmöglich eingehen kann. Sie werden dadurch noch schwieriger, dass sie durch historisch bedingte, weithin emotionale Vorurteile und Missverständnisse überlagert sind. Diese Art von Problemen kann man nicht theologisch lösen. Sie erfordern eine „Reinigung des Gedächtnisses“, sowie einen langfristig angelegten kulturellen und religiösen Austausch. So unterhält und finanziert der Päpstliche Einheitsrat u.a. ein umfängliches Stipendienprogramm. Letztlich lassen sich diese Probleme nur durch persönliche Begegnungen überwinden. So wie das Schisma zwischen Ost und West nicht zu einem bestimmten Datum erfolgte, sondern ein lange dauernder Prozess zunehmender Entfremdung war, so kann es heute nur in einem längeren Prozess der Wiederannäherung überwunden werden.
So ist es zwar erfreulich, dass der Dialog wieder aufgenommen werden konnte; aber es ist nach meiner Einschätzung im Augenblick offen, ob der mit vielen Hoffnungen neu begonnene Dialog in absehbarer Zeit zu einem weiterführenden Ergebnis führen wird. Angesichts der welt- und geistespolitischen Situation wäre es freilich unverantwortlich, aus kirchenpolitischen Motiven die gegenwärtige Chance ungenutzt verstreichen zu lassen. Ein solcher Kairós wiederholt sich nicht beliebig oft.
III.
Neben dem Begriff „Globalisierung“ gibt es ein zweites Stichwort, mit dem man die gegenwärtige Situation vor allem in Westeuropa beschreibt: „Säkularisierung“. Damit kommen wir zur gegenwärtigen Situation der westlichen Ökumene, d.h. zur Ökumene mit den direkt oder indirekt aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen Kirchen. Auch hier gab es seit den 70er Jahren große Fortschritte. Ich erinnere besonders an die Lima-Erklärungen von 1982 über „Taufe, Eucharistie und Amt“, an die ARCIC-Dialoge mit der anglikanischen Gemeinschaft und an die internationalen Dialoge mit dem Lutherischen Weltbund, besonders an die 1999 in Augsburg erfolgte feierliche Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, der sich 2006 in Seoul auch der Methodistische Weltbund angeschlossen hat.
Ein – zugegebenermaßen verkürzt geratener – Halbsatz in der Erklärung „Dominus Jesus“ (2000), der die protestantischen Kirchen theologisch nicht als Kirchen im eigentlichen Sinn, sondern als kirchliche Gemeinschaften einstuft, hat auf evangelischer Seite Kränkungen hervorgerufen, die durch alle urbi et orbi erfolgten Erläuterungen nicht geheilt werden konnten. Der Sache nach wollte dieser Halbsatz auf die unbestreitbaren und auch unbestrittenen Unterschiede im Kirchenverständnis hinweisen. Doch manchen scheint er willkommen zu sein um die eigenen ökumenekritischen Vorbehalte besser verstecken oder abreagieren zu können. Denn vergleicht man den inkriminierten Halbsatz mit sehr viel härteren Erklärungen aus der EKD, dann kann man „Dominus Jesus“ als ein vergleichsweise wohlwollendes ökumenisches Dokument bezeichnen. Es ist auch deshalb gut ökumenisch, weil es – abgesehen von diesem Halbsatz – im gesamten übrigen Text ein protestantisches Uranliegen, das „solus Christus“, zur Geltung bringt.
Wichtiger und langfristig entscheidender als diese atmosphärische Eintrübung des ökumenischen Verhältnisses scheint mir zu sein, dass die geistige Großwetterlage neuerdings kräftig in die Dialoge mit den Kirchen aus der Reformation hereinspielt. Ich muss es mir in diesem Zusammenhang versagen, auf die ganze Komplexität des Begriffs und des Phänomens der „Säkularisierung“ einzugehen. Eine legitime Säkularisierung, d.h. die Anerkennung der legitimen Autonomie der weltlichen Kultursachbereiche (Wissenschaft und Kultur, Wirtschaft und Politik u.a.) haben inzwischen alle historischen Kirchen anerkannt. Die katholische Kirche hat sich durch das II. Vatikanische Konzil klar in diesem Sinn ausgesprochen.
Die legitime Säkularisierung schlägt freilich zunehmend in Säkularismus um, d.h. in die Ideologie eines einseitigen, teilweise intoleranten Geltungsanspruchs innerweltlicher Gesichtspunkte, moderner und postmoderner Einstellungen, Lebensformen und Mentalitäten auch im geistlichen Bereich. Die Nachgiebigkeit gegenüber solchen Tendenzen hat zu einer inneren Säkularisierung mancher protestantischer Kirchen vor allem in ethischen Fragen geführt. Das wiederum hatte eine Fraktionierung zwischen einem mehr liberalen und einem mehr konservativen Flügel zur Folge. Die durch solche Polarisierung ausgelöste Krise kann man am deutlichsten bei der anglikanischen Gemeinschaft studieren, deren Zusammenhalt gegenwärtig ernsthaft auf dem Spiel steht. Ähnliche Fragmentisierungen finden sich auch in einer Reihe von protestantischen Kirchen. So gibt es gegenwärtig nicht nur Einigungs-, sondern auch neue Abspaltungs- und Zersplitterungs-prozesse.
Als Reaktion auf die Liberalisierung in Bekenntnisfragen wie in ethischen Fragen kam es zu einem starken Anwachsen evangelikaler, teilweise auch fundamentalistischer Strömungen und Gemeinschaften. Auch das geschichtlich beispiellose, atemberaubende Anwachsen der Pfingstgemeinden in der südlichen Hemisphäre, die Zunahme von alten und neuen Sekten wie von indigenen kirchlichen Gemeinschaften ist zu nennen. Diese Entwicklung stellt die ökumenische Bewegung vor große neue Herausforderungen. Um ihnen zu begegnen hat der Päpstliche Einheitsrat in den letzten beiden Jahren Seminare für Bischöfe und Theologen in Lateinamerika, Asien und Afrika veranstaltet; weitere sind in Vorbereitung. Die Probleme stellen sich auch in Nordamerika und zunehmend auch in Europa.
Schauen wir also auf Europa und betrachten wir die Entwicklung dort etwas aus der Nähe. In den Anfängen des katholisch-protestantischen Dialogs in den 70er und 80er Jahren konnte man von der gemeinsamen Bekenntnisgrundlage im Apostolischen und im Nicaeno-konstantino-politanischen Glaubensbekenntnis wie von den jeweiligen konfessionellen Bekenntnissen (vor allem vom Augsburger Bekenntnis von 1530) ausgehen. Im damaligen europäischen Protestantismus waren die Wort-Gottes-Theologie von Karl Barth und die Luther-Renaissance maßgebend. Heute dagegen kommen wieder liberale Motive zur Geltung, die man als durch Karl Barth überwunden glaubte.
Angesichts der Gefahr einer drohenden Auflösung der protestantischen Identität Bischof Wolfgang Huber (Berlin) darum, das Profil des Protestantismus neu zu schärfen. Er spricht von einer Ökumene der Profile. In der Tat, jeder Dialog setzt Partner mit eigenem Profil und eigener Identität voraus. Mit einer Schummel- und Kuschelökumene und mit einem Wischiwaschi-Christentum ist niemand gedient.
Die Ökumene der Profile hebt sich wohltuend von dem Vorschlag einer Differenzökumene ab. Sie bleibt aber mit ihrem an sich legitimen Anliegen auf halbem Weg stecken. Als protestantisches Profil gilt, was sich seit den 70er Jahren in Mitteleuropa im Bereich der Leuenberger Konkordie (1973) als Einheit in der Vielfalt herausgebildet hat. Danach ist zu unterscheiden zwischen dem verbindlichen gemeinsamen Grund des Glaubens und der kirchlichen Gestalt, bei der es einen weitgehenden Pluralismus vor allem im Verständnis und in der Gestalt des ordinierten Amtes geben kann. Damit gehen die protestantischen Kirchen in der Kirchen- und Amtsfrage hinter bereits erreichte Konvergenzerklärungen zurück. Man muss sogar von einem Auseinanderdriften sprechen. Auch in der Abendmahls- bzw. Eucharistielehre gibt es faktisch einen erheblichen Pluralismus.
Es ist deshalb schwer verständlich, wie man einerseits erreichte Übereinstimmungen aufkündigen und andererseits Abendmahls- bzw. Eucharistiegemeinschaft fordern kann. Man kann auch aus der Not der faktischen Fragmentierung nicht nachträglich eine theologische Tugend machen und diese als Kirche der Freiheit preisen. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Status-quo-Denken, dem es um die gegenseitige Anerkennung des faktisch bestehenden ekklesiologischen Pluralismus geht.
Dieses Konzept eines Kirchenfriedens ist nicht nur katholisch und orthodox nicht tragfähig. Es scheint mir auch nicht das zu sein, was Martin Luther und was das Augsburger Bekenntnis wollten. International ist es auch unter den lutherischen Kirchen nicht konsensfähig. Eine Reihe von lutherischen Kirchen (etwa Schweden und Finnland, von der nordamerikanischen Missouri-Synod gar nicht zu reden) lehnen es ab. Im internationalen Dialog kommen daher auch dialogisch offenere Positionen zur Geltung. Bei uns setzen sich einzelne Theologen, bekenntnistreue hochkirchliche, manche freikirchliche, evangelikale und pietistische Gruppierungen sowie einzelne Kommunitäten davon ab. Das bestätigt nochmals was wir als zunehmende Zersplitterung analysiert haben. Für uns wird es damit immer schwieriger, bei den historischen protestantischen Kirchen (mainline churches) klar identifizierbare Partner auf der internationalen Ebene zu finden.
IV.
Die wenigen Streiflichter, die ich in der Kürze der dafür zur Verfügung stehenden Zeit aufstecken konnte, könnten auf eine tiefe Krise der ökumenischen Bewegung hindeuten. Ich spreche stattdessen lieber von einem tief greifenden Wandel der ökumenischen Szene. Sie sortiert sich gegenwärtig neu. Dieser Prozess ist noch voll im Gang. Deshalb ist es schwer voraussehbar, wo wir in etwa zehn Jahren konkret stehen werden.
Es mag sein, und es zeichnet sich nach meiner Einschätzung auch ab, dass wir es dann einerseits mit bekenntnisfreien, in sich pluralistischen und darum wenig stabilen Gemeinden zu tun haben, die kaum mehr als Kirchen im herkömmlichen protestantischen Sinn zu identifizieren sind, und andererseits mit Kirchen des katholischen und orthodoxen Typs, an die sich die bekenntnistreuen evangelischen Gemeinschaften in der einen oder anderen Form anlehnen. Die Kirchen katholischen und orthodoxen Typs werden – da bin ich mir sicher – in Gehorsam gegenüber dem Auftrag Christi, aufgrund des gemeinsamen Bekenntnisses zur „una sancta ecclesia“ und angesichts der gemeinsamen Herausforderung durch den Säkularismus weiterhin einen ernsthaften ökumenischen Dialog miteinander führen, der hoffentlich zu konkreten Ergebnissen kommt.
Das II. Vatikanische Konzil hat im Ökumenismusdekret gleich zwei Mal gesagt, die ökumenische Bewegung verdanke sich einem Impuls des Hl. Geistes. Er ist der eigentlicher Akteur. Wir können die Einheit nicht machen. Sie ist das Werk des Geistes. Die geistliche Ökumene ist darum das Herz der Ökumene. Dieses Herz schlägt. Fast täglich kann ich in Gesprächen mit Bischöfen, Pfarrern, Theologen, Laien der verschiedensten Kirchen eine tiefe Sehnsucht nach Einheit feststellen. Es ist offenkundig, der Hl. Geist erlaubt sich, auch außerhalb der Mauern der eigenen Kirche kräftig zu wehen und auf Einheit zu drängen. So tut sich im Verborgenen viel mehr als die meisten ahnen.
Ich habe darum für die Zukunft der Ökumene keine Sorge. Ich tue, was ich hier und heute tun kann. Das konkrete Wie, Wann und Wo der vollen Einheit kann ich getrost dem Geist Gottes überlassen. Auf ihn ist Verlass. Er führt zu Ende, was er begonnen hat. Freilich, und das bekommen wir gegenwärtig zu spüren, seine Wege sind manchmal andere als wir es uns ursprünglich ausgedacht hatten. Doch – und damit will ich schließen – anders als hominum confusione, sed Dei providentia kann das Reich Gottes und kann auch die Ökumene nicht wachsen. In diesem Sinn: Trotz allem, die Karawane zieht weiter; die Ökumene marschiert.